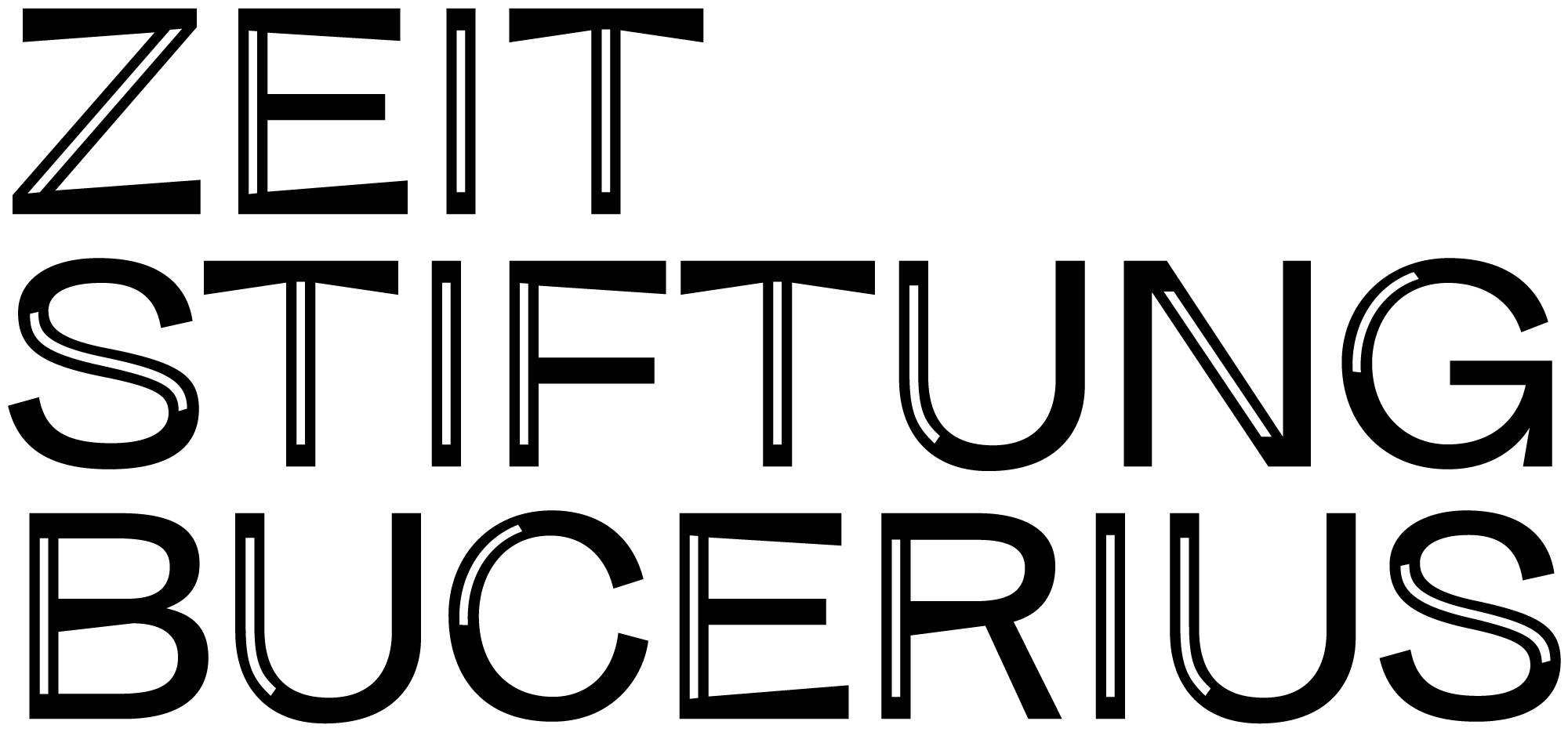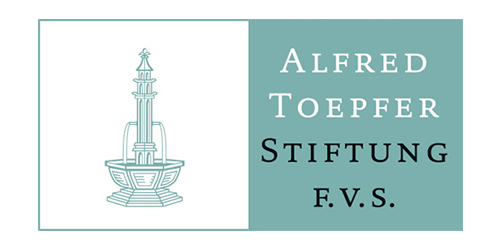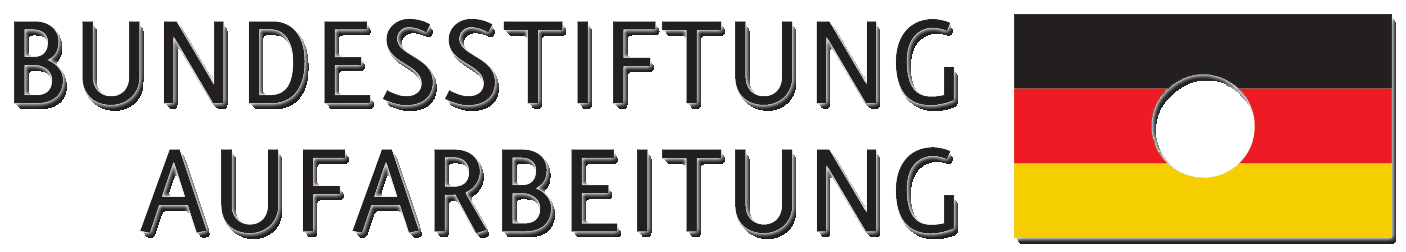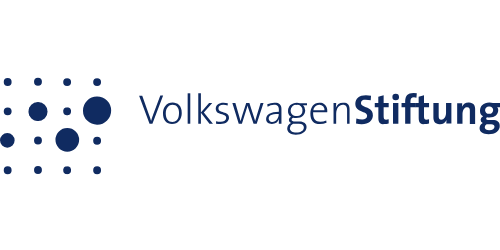Wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine wurden russische Fußballvereine und die Nationalmannschaft von allen europäischen und internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. So durfte die Sbornaja auch nicht an der Qualifikation zur EM, die aktuell in Deutschland stattfindet, teilnehmen. Der russische Fußball ist also isoliert. Dennoch spielten über 50 ausländische Spieler in der abgelaufenen Saison in der höchsten Spielklasse des Landes (die mal wieder Zenit St. Petersburg für sich entscheiden konnte).
Das russische Online-Medium The Insider hat sich diese Spieler im Fußball (und im Eishockey) genauer angeschaut und recherchiert, dass Spieler aus dem Ausland bei russischen Clubs auch eine Anstellung finden, obwohl gegen sie ermittelt wird.

Orenburgs Jordhy Thompson feiert sein Tor gegen den FK Rostow. In seiner Heimat Chile ist er wegen häuslicher Gewalt angeklagt / Foto © IMAGO/ITAR-TASS/Erik Romanenko
Ein Chilene, der seine Freundin brutal geschlagen haben soll
Im Januar 2024 verpflichtete der Fußballclub FK Orenburg den 19-jährigen Linksaußen Jordhy Thompson vom chilenischen Verein CSD Colo-Colo. Der Fußballer wird in seiner Heimat des versuchten Totschlags beschuldigt. Im November 2023 hatte die ehemalige Partnerin Thompsons, Camila Sepúlveda, bei der Polizei Anzeige erstattet: Der Fußballer soll sie in betrunkenem Zustand aus Eifersucht grausam geschlagen haben. Auch soll er versucht haben, sie zu erwürgen. Das war nicht das erste Mal: Im vergangenen Frühjahr hatte Camila den Fußballer zwei Mal gewalttätiger Übergriffe beschuldigt.
Am 6. November 2023 wurden gegen den vielversprechenden Stürmer 45 Tage Haft verhängt. Die wurden nach einigen Tagen in Hausarrest umgewandelt. Am 19. Dezember erreichten Thompsons Anwälte, dass diese Sicherungsmaßnahme für ein halbes Jahr ausgesetzt wurde, wobei der Beschuldigte das Land gegen eine Kaution von 100 Millionen Peso (rund 105.000 Euro) verlassen konnte. Bereits am 3. Januar 2024 verkündete Orenburg, dass die Papiere über seinen Wechsel als Leihspieler unterschrieben sind.
Im Januar, mitten in der Winterpause der russischen Premjer Liga, wurde der Fall Jordhy Thompson heftig diskutiert. Auslöser war ein höchst merkwürdiges Statement von Dmitri Andrejew, dem Sportdirektor von Orenburg. Der ehemalige Fußballer, der gleich nach seinem Karriereende 2019 zum Clubmanager aufstieg, wurde direkt gefragt, ob der Verein nicht von der Vorgeschichte des Chilenen irritiert sei.
Das war aber keineswegs der Fall:
„Eine dunkle Seite bei Thompson? Wer hat die nicht? Von den Problemen mit der Freundin haben wir gehört. Sie reden so, als ob er zwanzig Frauen plattgemacht hätte. Wir machen uns um das Ansehen von Orenburg keine Sorgen. Wem passiert das nicht? Wir haben ihn nicht unter die Lupe genommen. Uns war klar: Wenn es nicht die Probleme mit seiner Freundin gegeben hätte, hätten wir uns einen solchen Spieler nicht leisten können. Als er in diese Lage geraten war, haben wir alles drangesetzt, ihn zu bekommen“, führte Andrejew in einem Interview für Sport24 aus.
Hätte es keine Probleme mit dem Gesetz gegeben, hätte sich Thompson sicher bei Colo-Colo weiterentwickeln können. Oder er hätte sogar mit dem Wechsel in eine stärkere europäische Liga liebäugeln können, wie sein ehemaliger Trainer Gualberto Jara meint, der mit Thompson im Jugendbereich des chilenischen Spitzenclubs gearbeitet hat. Im Gespräch mit The Insider bestätigte ein Experte, der in Spanien zum Staff von Racing Santander und Rayo Vallecano gehörte, dass Thompson dieses Potenzial hat.
Jewgeni Jeremjakin, Präsident des Clubs und stellvertretender Generaldirektor von Gazprom Förderung Orenburg, räumte im Januar ein, dass ihm die Sache mit dem neuen Spieler trotzdem Sorgen bereitet: „Deswegen leihen wir ihn erstmal bis zum Saisonende aus. Und werden ihn erziehen.“
Für den FK Orenburg, der die ganze Saison ums Überleben in der russischen Premjer Liga kämpfte, bedeutet Thompson zweifellos eine Verstärkung: Er stand bei allen Spielen in der Startelf und erzielte zwei Treffer (einen davon im russischen Pokal). The Insider hat beim FK Orenburg nachgefragt. Bis zur Veröffentlichung des Artikels ist keine Antwort eingegangen.
Ein Niederländer, der bei einem Verkehrsunfall den Tod eines Kindes verschuldete
Rai Vloet, Legionär bei Ural Jekaterinburg, wurde im April 2023 in den Niederlanden zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, weil er angetrunken einen Verkehrsunfall verursachte, bei dem ein vierjähriges Kind starb. Sein Wagen hatte auf dem Weg zum Amsterdamer Flughafen Schiphol das Fahrzeug einer Familie mit zwei Kindern gerammt. Eines der beiden Kinder erlag seinen schweren Kopfverletzungen. Der Unfall ereignete sich am 14. November 2021. Vloet leugnete anfangs hartnäckig, dass er am Steuer saß (ein Freund war mit ihm im Wagen). Dann stritt er ab, dass er viel zu schnell gefahren war. Die Ermittlungen ergaben, dass sein Fahrzeug vor dem Aufprall eine Geschwindigkeit von 203 Stundenkilometern hatte. Der Alkoholpegel der beiden Männer lag beim Doppelten des Grenzwerts. Es stellte sich heraus, dass die beiden von einer Party zur nächsten unterwegs waren.
Anfangs versuchte Vloets Bekannter, mit einer Falschaussage die Schuld auf sich zu nehmen. Letztendlich sagten aber beide wahrheitsgemäß aus. Die Verteidigung hob darauf ab, dass das getötete Kind nicht angeschnallt war. Vor dem tödlichen Unfall hatte Vloet, der bei PSV Eindhoven ausgebildet wurde, einem der erfolgreichsten Vereine des Landes, in der Eredivisie, der höchsten niederländischen Liga gespielt. Bei Heracles Almelo, das im Mittelfeld rangiert, war er einer der Führungsspieler. Nach dem Prozess gegen ihn meldeten sich aktive Fans des Clubs zu Wort: Sie bekräftigten, dass es beschämend und unmöglich sei, ihn aufs Feld zu schicken, als ob nichts gewesen wäre. Selbst, wenn die Berufung noch laufe. Danach nahm Heracles die gleiche Haltung ein. Vloet wurde vom Training suspendiert und verkündete im Januar 2022, dass er nicht mehr für die Mannschaft spielen werde.
Um nicht ohne Spielpraxis und Gehalt dazusitzen, fand er einen neuen Job in Kasachstan: Astana FK verpflichtete ihn ablösefrei. Dort wusste man bestens über die Situation Bescheid. Innerhalb der Mannschaft war das Thema aber tabu, erläuterte der Sportdirektor von Astana FK, Igor Pawljuk, gegenüber The Insider. Er war seinerzeit leitend in der Verwaltung tätig. Für Ural Jekaterinburg, das den schillernden und umstrittenen Holländer im September 2022 für 250.000 Euro verpflichtete, spielten moralische Fragen überhaupt keine Rolle. Das hatte der Vizepräsident des Clubs, Igor Jefremow, seinerzeit eingeräumt. In der YouTube-Show Das ist Fußball, Bruder erinnerte sich der nun schon ehemalige Mitarbeiter von Ural:
„Wenn du die Situation nicht kennst, stellt sich die Frage: Warum spielt dieser Spieler in Kasachstan? Wir haben uns mit der Situation beschäftigt und alles diskutiert. Als Vloet bei Ural unterschrieb, hatte es noch keine Entscheidung des Gerichts gegeben. Ich sage ganz ehrlich: Die moralische und ethische Seite wurde überhaupt nicht erörtert.“
Auf die Frage der Moderierenden, ob das in Ordnung sei, bemerkte Jefremow: „Sagen wir mal so: Gibt es wirklich viele Leute, die in ihrem Leben immer nüchtern hinterm Steuer sitzen?“ Und er fasste zusammen: „Wir diskutieren diese Situation hier jetzt länger, als wir sie damals diskutiert haben.“ Der Anwalt des Fußballers Erik Thomas kommentierte die Lage, indem er das Offensichtliche aussprach: „Es ist nicht so interessant, in Kasachstan oder Jekaterinburg zu spielen, wenn du Europa gewohnt bist. Aber kein einziger europäischer Club wollte ihn bei sich sehen.“
Sowohl der frühere Anwalt des Fußballers als auch der ehemalige Vizepräsident von Ural, Igor Jefremow, behaupteten: Sobald das abschließende Urteil nach der Berufung feststeht, wird sich Vloet nicht mehr verstecken und in den Niederlanden seine Strafe verbüßen. Ihren Aussagen zufolge ist der Spieler bereit für eine Gefängnisstrafe, wie lang sie auch sein mag. The Insider hat bei Ural Jekaterinburg nachgefragt. Bis zur Veröffentlichung des Artikels ist keine Antwort eingegangen.
Ein Niederländer, der mit Kokain handelte
Der aufsehenerregendste Kriminalfall im russischen Fußball steht allerdings nicht mit einer Verstärkung eines Clubs in Verbindung, sondern mit einem Abgang. Der Niederländer Quincy Promes, Führungsspieler bei Spartak Moskau, saß bis zuletzt noch in einem Gefängnis in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), und zwar wegen eines Auslieferungsantrags aus den Niederlanden. Im vergangenen Sommer war Promes dort zu anderthalb Jahren verurteilt worden, weil er seinen Cousin im Laufe eines Streits in der Familie mit einem Messer verletzt hatte. Im Winter kamen wegen Kokainschmuggels sechs Jahre hinzu. Zwischen diesen Verfahren besteht allerdings keine Verbindung. Die Ermittlungen wegen Drogenschmuggels hatten bereits 2018 begonnen, während der Konflikt mit dem Cousin erst 2020 erfolgte.
Quincy Promes war schon 2014 zu Spartak gewechselt und wurde dort nicht nur zu einem Star, sondern zu einer echten Legende. Er war 2017 Mitglied der Mannschaft, die die Meisterschaft holte, zum ersten Mal nach 16 Jahren. Im Mai 2023 wurde er zum besten Stürmer des Clubs in der postsowjetischen Vereinsgeschichte. Und er wurde zum erfolgreichsten ausländischen Torschützen der russischen Ligageschichte.
Es gab einen dritten Vorfall mit Promes, der an sich relativ unbedeutend war. Doch ohne diesen Fall wäre er wohl nicht hinter Gittern gelandet. In der Winterpause 2023-2024 flog Quincy in den Urlaub nach Dubai (in der Europäischen Union wollte er sich nicht sehen lassen, weil er in Abwesenheit wegen des Angriffs auf seinen Cousin verurteilt worden war). Dort hatte er mit einem Mietwagen einen Unfall mit einem Bus verursacht und war vom Unfallort geflüchtet. Bald darauf flog er nach Moskau, um danach mit Spartak ins Trainingslager in die Emirate zurückzukehren. Dem Verein hatte er dabei nichts von dem Unfall erzählt.
Das Urteil von sechs Jahren Gefängnis wegen des Drogenschmuggels wurde am 14. Februar bekannt, als Promes sich mit Spartak in den Emiraten aufhielt. Zwei Wochen später wurde er nicht in den Flieger seines Vereins gelassen, der ihn zurück nach Russland bringen sollte. Das erfolgte aufgrund der Rechtsverletzung in den Emiraten. Der Grenzschutz der Emirate hatte die Informationen zur Flucht vom Unfallort erhalten. Bald schon wurde die niederländische Seite aktiv. In den Emiraten ging ein Auslieferungsantrag ein, und der Fußballer wurde festgenommen. Ende März berichtete De Telegraaf, Promes habe ein Gerichtsverfahren zu erwarten. Bis zu einer Entscheidung über die Auslieferung bleibe er unter gewöhnlichen Bedingungen in Haft. In seiner Zelle, die für sechs Personen ausgelegt ist, sitzen rund 20 weitere Häftlinge. Am 17. Mai wurde berichtet, dass der Fußballer auf Kaution freigelassen wurde, die Emirate aber nicht verlassen darf.
Aus den niederländischen Ermittlungen geht hervor, dass für Promes zwei Lieferungen Kokain aus Brasilien im Hafen von Antwerpen eintrafen mit einem Gesamtgewicht von 1362 Kilogramm. Die Ware war als Meersalz in Säcken getarnt. Nach Angaben der Ermittler hatte der Spieler von Spartak 200.000 Euro investiert, um sechs Millionen herauszuholen. Promes hatte Komplizen (darunter seinen Onkel), stand aber an der Spitze dieser Miniorganisation. Daher wurde für ihn das höchste Strafmaß von allen gefordert. „Allem Anschein nach hält sich Promes für unantastbar, sei es in Russland oder in anderen Ländern. Mich würde interessieren, wie ein erfolgreicher Fußballer sich derart in Verbrechen verstricken konnte“, zitiert die NL Times den Staatsanwalt.
Spartak verweist die ganze Zeit auf das laufende Berufungsverfahren und löst den Vertrag mit Promes nicht auf. RBK zufolge ist es für den Club juristisch möglich, den Vertrag zu kündigen: Als er 2021 unterzeichnet wurde und die Ermittlungen zum Angriff auf seinen Cousin schon bekannt waren, hatte Spartak eine Klausel darüber eingefügt, dass der Vertrag ohne weitere gegenseitige Ansprüche aufgelöst werden kann, falls der Spieler nicht mehr für die Mannschaft spielen kann.
Höchstwahrscheinlich wird Promes nicht mehr für Spartak spielen, auch wenn der Vertrag bis Juni nächsten Jahres läuft. Wenn der Unfall mit dem Mietwagen nicht gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich mit der Mannschaft nach Russland zurückfliegen und weiter in der Premjer Liga spielen können. Aus Russland hätte man ihn wohl kaum an die Niederlande ausgeliefert. Darauf wies gegenüber The Insider Andrej Morosow hin, ein Anwalt der Kanzlei Feokistow und Partner: „Die Entscheidung über eine Auslieferung trifft praktisch die Generalstaatsanwaltschaft. Das ist ein außerordentliches Verfahren, weswegen eine Auslieferung aus politischen Motiven erfolgen kann (oder eben nicht erfolgen kann).“
Bereits vor seiner Inhaftierung in Dubai hatte Promes wohl versucht, sich durch eine russische Staatsangehörigkeit abzusichern. Vor einem Jahr wurde bekannt, dass ihm Spartak dabei half. Das russische Sportministerium verweigerte jedoch wegen des laufenden Gerichtsverfahrens seine Mitwirkung. Wenn der Niederländer die russische Staatsangehörigkeit erhalten hätte, wäre er auf russischem Hoheitsgebiet in Sicherheit gewesen, weil Russland seine Staatsangehörigen nicht ausliefert. Übrigens droht Promes auch in Russland ein Strafverfahren, nämlich wegen systematischer Nichtzahlung von Steuern. Dem Portal Mash zufolge schuldete er dem Finanzamt 397.000 Rubel, bevor er zum Trainingslager in die Emirate flog.
Ein Amerikaner, der Polizisten angriff
Im Sommer 2023 unterzeichnete SKA Petersburg, einer der Spitzenclubs der Kontinentalen Eishockeyliga (KHL), finanziert von Gazprom, einen Vertrag mit Alex Galchenyuk, einem US-Amerikaner belarussischer Herkunft. In seiner Jugend hatte er einen russischen Pass und eine Einladung in die russische Sbornaja. Galchenyuk lehnte jedoch sowohl eine Nominierung wie auch den Pass ab. Er war dann aber genötigt, über Angebote aus Russland nachzudenken, nachdem der gerade erst unterschriebene Vertrag mit den Arizona Coyotes aus der National Hockey League aufgelöst wurde.
Mitte Juli letzten Jahres war Galchenyuk wegen eines Angriffs auf Polizisten verhaftet worden. Er war mit seinem Vater mit einem BMW in einen Unfall verwickelt. Der Wagen war gegen den Bordstein geraten und hatte ein Verkehrsschild und ein Auto daneben beschädigt. Als die Polizei am Unfallort eintraf, fand sie den Eishockeyspieler einige Meter vom Wagen liegend betrunken vor. Bei der Festnahme leistete er Widerstand, wurde grob und drohte den Polizisten. Auf einem später in Umlauf gebrachten Video der Polizeikameras ist deutlich zu hören, was Galchenyuk den Polizeibeamten sagte: „Ist dir klar, dass ich dich einfach absteche? Die Kehle schneide ich dir durch … Du weißt, dass ich Abramowitschs Nummer habe… Und ihr alle seid am *** … Lass mich aus dem Wagen, sonst werden alle eure Kinder, alle eure Frauen, alle eure Töchter sterben. Ein Anruf von mir, und ihr seid tot“. Darüber hinaus erlaubte er sich rassistische Äußerungen gegenüber einem der Polizisten.
Der Spieler entschuldigte sich später öffentlich, doch gab es bereits keinen Weg zurück in die NHL. In solchen Fällen bieten die Clubs den Betroffenen gewöhnlich einfach keinen Vertag mehr an, zumindest bis zu einer Rehabilitierung. Galchenyuk erhielt nun Angebote aus Russland, wobei er sich für SKA Petersburg entschied. Roman Rotenberg, der Cheftrainer von SKA und gleichzeitig dessen Vizepräsident und stellvertretender Vorsitzender des Direktorenrats (sowie Sohn des Geschäftsmanns Boris Rotenberg), war begeistert, dass Galchenyuk sich für seinen Club entschied: „Wir sind froh, dass ein Hockeyspieler von diesem Niveau zu uns gestoßen ist. Wie man so sagt, ein Gottesgeschenk. Weil es ganz und gar nicht einfach ist, einen solchen Spieler zu bekommen.“
Und bei der Vorstellung des neuen Spielers erklärte Rotenberg noch vor den Fragen zu dem Vorfall: „Alex passt rundum in unser System. Von den menschlichen Qualitäten her wie auch als Spieler.“ Auf Nachfragen von The Insider an SKA über die Vertragsunterzeichnung und die Zukunft von Galchenyuk gab es keine Antwort.
Was die Sportfunktionäre sagen
Der Fall Quincy Promes verlangt in Bezug auf den Zustrom von Spielern mit Reputationsproblemen nach einer Stellungnahme führender Vertreter des russischen Fußballs. Maxim Mitrofanow, Generaldirektor des Russischen Fußballverbandes erklärte auf die Frage nach dem Image der russischen Premjer Liga als einer Liga von Kriminellen, dass man die russische Meisterschaft so nicht bezeichnen könne und fügte hinzu: „Das ist eher eine Frage an die Arbeitgeber. Hier entscheidet jeder selbst, ob er bereit ist, mit einem Menschen zusammen zu arbeiten, der eine Straftat begangen oder nicht begangen hat.“ Und der Chef der Premjer Liga Alexander Alajew formulierte es nach einer Mahnung daran, dass bis zum Ende des Berufungsverfahrens niemand als Verbrecher bezeichnet werden dürfe wie folgt:
„Wenn die Schuld eines Spielers bewiesen ist, kann er nicht mehr in der Premjer Liga spielen. Fußballer sind ein Vorbild für Kinder; für meinen Sohn ist Promes ein Heiliger. Wir verfolgen die Situation von Promes und von Vloet mit Hilfe von Juristen. Wir können ihnen nicht verbieten zu spielen. Wir werden verfolgen, wie die Sache ausgeht. Aber Menschen, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind, sollten kein Teil der Liga sein. Das ist meine Meinung.“
Juristische Instrumente, um Verträge mit solchen Spielern zu verbieten, gibt es weder bei den Ligen (der Premjer Liga und der KHL), noch bei den Verbänden.