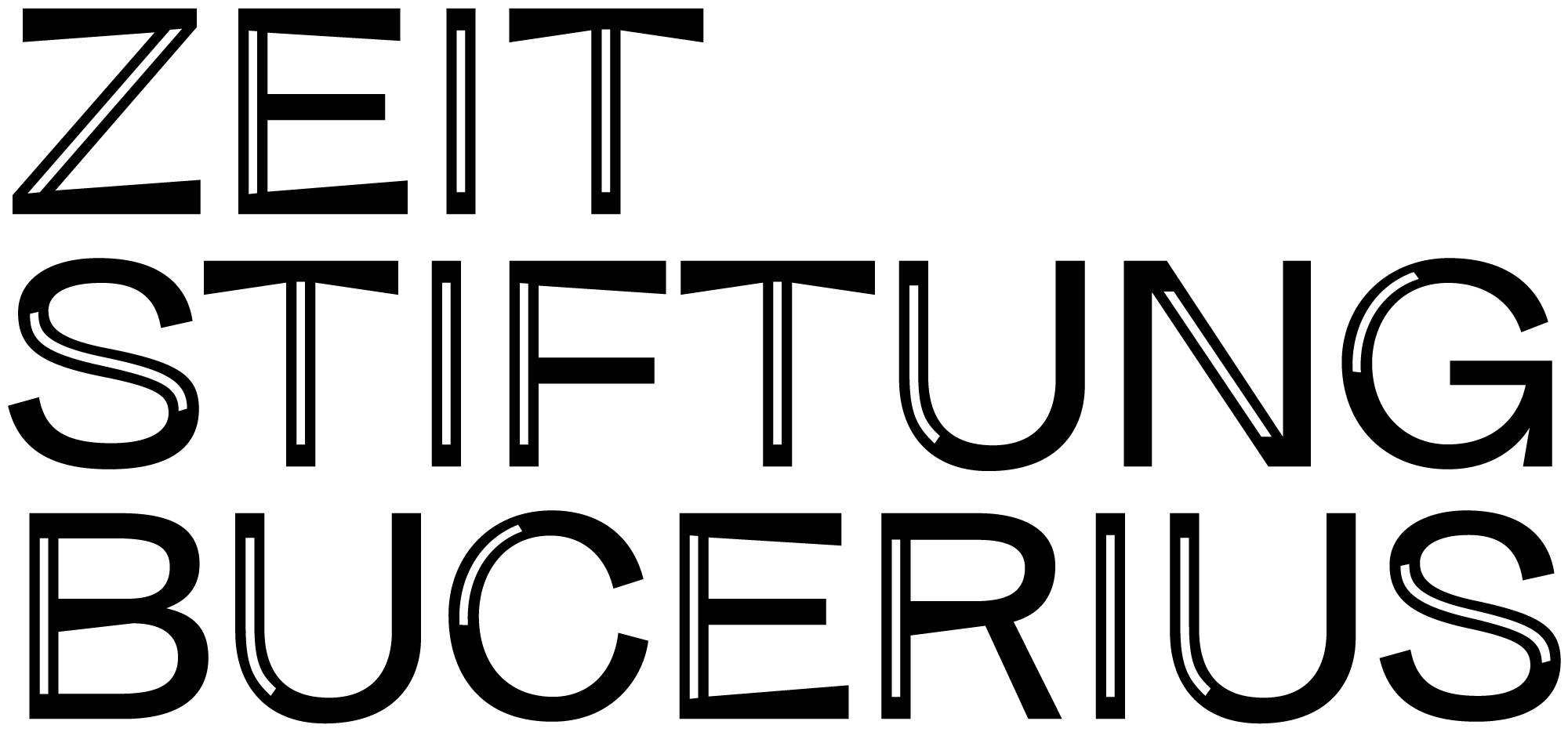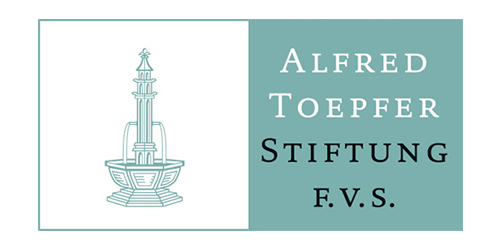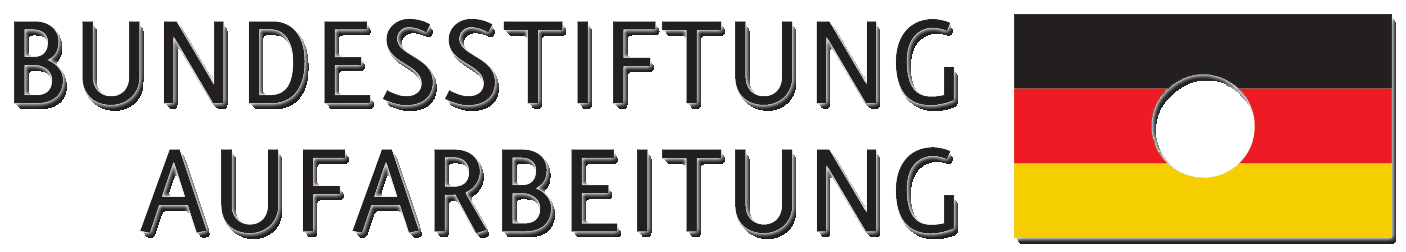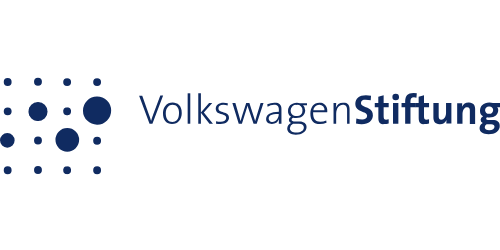„Wenn du eine Frau mit zum Angeln nimmst, wirst du nichts fangen“ – Weisheiten dieser Art füllen in Russland beliebte Kalender für Angler. Eine andere lautet: „Trifft ein Mann auf dem Weg zum Angeln eine alte Frau, bringt das Unglück. Zeigt er ihr aber im Vorbeigehen den Finger und spricht einen Fluch, dann bringt das Glück.“ Und ein Aberglaube besagt, dass eine Frau nicht mit ihrem Mann streiten soll, wenn er zum Angeln geht – sonst ist es ihre Schuld, wenn er ertrinkt.
In Gegenden, in denen es kaum Arbeit gibt und die Renten nur für das Nötigste reichen, ist der Fischfang nach wie vor wichtig für den Nahrungserwerb. Dort fischen auch viele Frauen das ganze Jahr über. Nicht zum Vergnügen, sondern um zu überleben. Obwohl: zum Vergnügen schon auch. Takie Dela hat einige Dörfer in Karelien besucht, gleich an der Grenze zu Finnland, und ist dort mit Frauen zum Winterfischen gegangen. Wie sich herausstellte, waren sie alle Rentnerinnen. Und fast alle waren Witwen. Gemeinsam war ihnen die Überzeugung, dass der Fischfang sie rettet – jede auf ihre eigene Weise.

In vielen karelischen Häusern hängt ein getrockneter Hecht-Schädel über dem Eingang in die Wohnstube. Sein Maul ist mit hunderten Zähnen besetzt, die sich nach innen biegen. Der Volksglaube besagt: Wenn ein Gast mit bösen Absichten kommt, dann schluckt der Hecht das Böse und lässt es nicht wieder heraus / Foto © Takie Dela
Einen Zander zu fangen ist erhabener und süßer als die Liebe.
– Аnton Tschechow
Antonina Karlowa im Dorf Woknawolok

Durch das Fenster ihres kleinen Hauses sieht Antonina Karlowa direkt auf den See Werchneje Kuito. Früher ist sie regelmäßig mit ihrem Mann zum Fischen gegangen. Als er starb, hatte gerade die Laichzeit begonnen. „Ich habe das Boot und einen Motor, ich habe die Netze, ich kenne die guten Plätze“, dachte Antonina. „Ich werde doch jetzt keinen Fisch kaufen!“ / Foto © TakieDela

Ein Webstuhl für Fischernetze. Die Schlaufen werden größer oder enger geknüpft – je nach dem, welche Fische man fangen möchte. Seit Jahrhunderten ernähren sich die Menschen hier von der Fischerei, sammeln Pilze und Beeren. Einige gehen auch auf die Jagd. Von dem Geld, das sie mit dem Verkauf von Moltebeeren, Moosbeeren, Preiselbeeren und Heidelbeeren verdienen, reparieren sie ihre Häuser und kaufen das Nötigste / Foto © Takie Dela

Antonina Karlowa und ihr Enkel Miron haben Löcher in das dicke Eis gebohrt. Jetzt warten sie auf den ersten Biss. In Woknawolok fischen alle von klein auf bis ins hohe Alter. Je nach Jahreszeit mit Schleppangeln, mit der Grundangel, mit Reusen oder Netzen. Mehr als alle anderen angeln Rentner und Rentnerinnen. Wer arbeiten muss und Kinder hat, hat keine Zeit, am Wasser zu sitzen. Mit dem Alter kommt die Freiheit / Foto © Takie Dela

In dem feinen Sieb wird der Rogen der kleinen Maräne gewaschen. „Zur Laichzeit hat mein Mann früher immer Urlaub genommen“, erinnert sich Antonina. „Er steuerte das Boot, und ich habe zuhause mit Freundinnen die Fische ausgenommen und konserviert – in Öl, in Tomatensoße, viel haben wir auch eingefroren. Das hat uns für den ganzen Winter gereicht.“ / Foto © Takie Dela
Als ihr Mann vor zwölf Jahren starb, traute Antonina sich zunächst nicht, allein mit dem Boot auf den See hinaus zu fahren. Also fragte sie ihre Nachbarin Galja, ob sie mitkommt. Nach dem ersten Mal hatten sie’s raus und die beiden wurden dicke Freundinnen. „Als im Frühling die Maränen kamen, sind wir rausgefahren und haben unsere Netze aufgestellt“, erinnert sich Antonina. „Ringsum waren Männer in ihren Booten unterwegs, und mittendrin wir zwei Frauen. Die Männer haben ihre Mützen geschwenkt und uns zugewunken.“ Spott habe sie nie gehört. In ihrem Dorf haben alle Respekt vor den Fischerinnen.
Vor einem Jahr hatte ihre Freundin einen Schlaganfall. Seitdem fischt Antonina allein. „Wir haben immer viel gelacht mit Galja, das Angeln hat uns so viel Spaß gemacht“, erzählt sie. „Wenn wir um sieben Uhr früh zusammen rausgefahren sind, die Sonne aufging und der Kuckuck rief. Herrlich! Dann haben wir die Ruder aus dem Wasser gezogen, inngehalten und gelauscht.“
Heute findet Antonina nur noch selten eine Begleitung: „Kaum jemand mag mit mir Angeln gehen, weil man mich dann nur schwer wieder nach Hause kriegt. Wenn ein Fisch an meinem Köder spielt, kann ich bis zum Abend auf dem Eis sitzen“, sagt sie. Die Kälte macht ihr nichts aus: Mehrere Schichten Kleidung und eine Kiste mit einem Fell zum Sitzen, damit kann sie es stundenlang aushalten. „Nur die Eislöcher kann ich nicht mehr selbst bohren, meine Hand schmerzt. Also bitte ich meinen Nachbarn, der hilft gern.“

In einem Bastkorb wird Trockenfisch aufbewahrt. Im Nordwesten Russlands trocknen viele ihren Fisch noch zuhause im russischen Ofen, der gleichzeitig Herd ist und die Stube heizt. Antonina schickt ihren Fang ihren Kindern, die in der Stadt wohnen. Die Katzen in der Nachbarschaft bekommen auch was ab. Sie sei zufrieden mit ihrem Leben, sagt sie. Langeweile kennt sie nicht. Sie singt im Chor, sie besucht den Karelisch-Kurs im Kulturhaus, sie strickt und stickt, und im Sommer hat sie ihren Garten mit dem Gewächshaus und den Wald mit Pilzen und Beeren. Und natürlich den See mit den Fischen / Foto © Takie Dela
Nadeshda Kirillowa, Woknawolok

Nadeshda Kirillowa zieht vier Paar Strümpfe übereinander, bevor sie an den See geht. Oft verbringt sie dort den ganzen Tag. Die 76-Jährige hat in Woknawolok den Ruf, die eifrigste Anglerin des Dorfes zu sein / Foto © Takie Dela

Barsche und Rotaugen lieben Maden. Nadeshda hat für sie immer einen kleinen Vorrat davon zuhause in ihrem Kühlschrank / Foto © TakieDela

Mit einem selbstgebauten Schlitten fährt Nadeshda zu ihrem Angelplatz. Ihr Hund Milli begleitet sie. Ihr Mann lebt nicht mehr. Er war ein starker Trinker. Vor fünf Jahren ist er eines Morgens nicht mehr aufgewacht. Es war Nadeshdas Geburtstag. „Ich habe ihm immer wieder gesagt: ‚Witja, hör auf mit dem Trinken, du sollst am Leben bleiben“, erzählt sie mit leiser Stimme. „Zuerst habe ich ihn geliebt, dann tat er mir leid. Als wir ihn beerdigt hatten, dachte ich: ‚Jetzt gehe ich erstmal angeln‘.“ / Foto © Takie Dela

Ungeduldig springt Milli herum, während Nadeshda ein Loch ins Eis bohrt. Sie will keinen neuen Mann: „Ich habe schon zwei Männer, meine Söhne. Und im Dorf gibt es niemanden, der mir gefällt. Worüber soll ich mit denen denn reden? Ich habe mich ans Alleinsein gewöhnt.“ / Foto © Takie Dela

Der Schlitten dient beim Angeln als Sitz. Der erste Barsch passt leicht in einen Fußstapfen von Nadeshdas Winterschuhen. Für sie ist die Fischerei beides – Nahrungserwerb und Vergnügen. „Ich muss mit meiner Rente auskommen, und die Fische ernährt mich. Mal salze ich welche ein, mal koche ich eine Suppe, mal mache ich eine Pastete. Am meisten mag ich gebratene Barsche und Fischfrikadellen. Für den Hund koche ich Getreidebrei mit Fisch. Und dann habe ich ja noch den Gemüsegarten, Hunger leiden müssen wir nicht.“ / Foto © Takie Dela

Zwei Jacken, zwei Pullover, eine Strickjacke, eine warme Weste, drei Hosen und vier Paar Socken – dick eingepackt wie eine Zwiebel kann Nadeshda den ganzen Tag auf dem Eis verbringen, ohne zu frieren. „Meine Großmutter hat auch viel geangelt“, erzählt Nadeshda. „Sie hat elf Kinder geboren, fünf haben überlebt, und es war schon nicht leicht, die durchzufüttern. Damals haben alle Frauen hier gefischt. Die Männer hatten anderes zu tun, die haben sich um die Ernte gekümmert, Holz gehackt. Unsere Großmütter haben gefischt, um zu überleben. Als ich klein war, standen im ganzen Haus Fässer: Im einen Barsche, im andern eingesalzene Rotaugen. Viele haben wir auch getrocknet. Nachdem mein Vater starb, habe ich die Netze zusammen mit meiner Mutter aufgestellt.“ / Foto © Takie Dela

Die besten Tage seien die, an denen ihre Söhne nicht trinken, sagt Nadeshda. Sie macht sich Sorgen, wenn sie nicht nach Hause kommen. Dann lässt sie die Tür geöffnet, wenn sie ins Bett geht, liegt wach, versucht, sie am Telefon zu erreichen. Allein mit der Angel auf dem See kommt sie zur Ruhe: „Im Winter, wenn ringsum alles weiß ist und still. Herrlich!“ Noch lieber mag sie den Sommer, da kann sie sich noch länger in die Einsamkeit zurückziehen. Manchmal mag sie gar nicht heimgehen, erzählt die 76-Jährige, dann übernachtet sie in ihrem Boot: „Ich schlafe wenig. Ich sitze einfach da, trinke Tee und schaue in die Sterne.“ / Foto © Takie Dela
Olga Pekschujewa, Woknawolok

Olga Pekschujewa unterrichtet seit 36 Jahren Mathematik und Physik an der Dorfschule. Neuerdings leitet sie auch einen Schachkurs und gibt Sportunterricht. Im Winter fährt sie auf Skiern zu ihren Angelplätzen. Sie hat ihre Söhne und einige Schüler mit ihrer Leidenschaft angesteckt. Zusammen nehmen sie an Angelwettbewerben in der Umgebung teil / Foto © Takie Dela

Auf Olgas Esstisch steht ein Teller mit gekochtem Fisch. Ihre Begeisterung für die Fischerei hat sie von ihrem Mann. „Er war Karelier, und die Karelier sind alle Fischer“. Vor zwei Jahren ist er gestorben, mit gerade 55 Jahren. „Krebs, und getrunken hat er auch“, sagt Olga. Seitdem geht sie mit ihren beiden erwachsenen Söhnen fischen / Foto © Takie Dela

Beim Eisangeln trägt Olga oft die Dienstjacke ihres verstorbenen Mannes. Er war beim Katastrophenschutz. Die beiden hatten vier Kinder zusammen. Die beiden Töchter haben geheiratet und sind weggezogen. Ihre Söhne Roma, 26, und Pascha, 17, leben noch zuhause. Sie machen oft gemeinsam Ausflüge, schnallen sich Jagdskier unter und wandern durch den Wald zu einem See. „Ich liebe solche Wanderungen“, sagt Olga: „Lagerfeuer, ein Kessel mit Tee.“ Für sie ist Angeln vor allem ein Vergnügen und ein Mittel, um mit ihren Kindern und Schülern in Kontakt zu bleiben / Foto © Takie Dela

Olgas jüngster Sohn Pascha und zwei ihrer Schüler ziehen mit dem Eisbohrer los. Im Winter wird der Fang an Land sofort tiefgefroren und bleibt schön frisch / Foto © TakieDela
Ljubow Filippowa, Siedlung Wedlosero

Eine Holzskulptur am Ufer des Sees in Wedlosero. Die Siedlung liegt im Zentrum von Karelien / Foto © Takie Dela
Ljubow Filippowa sitzt mit ihrem Vater an einem Eisloch und wartet auf einen Biss. Er hat sie schon mit zum Angeln genommen, als sie noch ein kleines Mädchen war. Dann heiratete sie, begann zu arbeiten und bekam Kinder – und für das Angeln war kaum noch Zeit. Vor kurzem hat sie ihre Stelle bei der Gebietsverwaltung gekündigt. Jetzt zieht sie auch manchmal alleine los / Foto © Takie Dela

Die Angel, die sich ihr Vater als Kind selbst gebastelt hat, benutzt er heute noch. Früher sei sie der Ansicht gewesen, Angeln sei nur etwas für Männer, sagt Ljubow Filippowa. Seit sie allein angelt, hat sie ihre Meinung geändert. Obwohl – ein paar Besonderheiten gibt es schon: Die Eislöcher bohrt immer noch ihr Vater für sie. Und wenn sie mal muss, während sie da mitten auf der weiten Eisfläche des Sees sitzt, hat sie ein Problem. Die meisten Männer gehen dann allerdings auch ans Ufer. Ein Aberglaube besagt, dass es Unglück bringt, aufs Eis zu pinkeln / Foto © Takie Dela

Ein anderer Aberglaube besagt, dass man auf dem See nicht fluchen und sich nicht über einen schlechten Fang beklagen darf. Wenn der erste Fang der Saison ein Erfolg war, haben die Karelier früher am Ufer eine Suppe daraus gekocht und sie für den Herren des Wassers zurückgelassen. Davon versprachen sie sich Petri Heil für die ganze Saison.
Ljubow Filippowa hält nichts von solchen Volksweisheiten und auch nichts von Anglerkalendern, in denen die günstigen Tage markiert sind. Wenn sie Lust hat, geht sie angeln. Wenn nicht, bleibt sie zuhause / Foto © Takie Dela

Nacht über dem See von Wedlosero. An einem Eisloch brennt noch Licht / Foto © Takie Dela
Valentina Moissejewa, Tschornaja Lamba

Valentina Moissejewa prüft eine Reuse. Die 64-Jährige lebt mit ihrem Mann, einem Sohn und zwei kleinen Enkelkindern in dem kleinen Dorf Tschornaja Lamba. Hier gibt es noch nicht einmal richtige Straßen. Dafür liegt das Dorf zwischen zwei Seen / Foto © Takie Dela
Auf dem Weg zum See. Valentinas Sohn steuert den Motorschlitten. Valentinas Mutter war in einer Kolchose für die Aufzucht der Kälbchen verantwortlich. Von frühester Kindheit an half Valentina mit: molk die Kühe, gab den Kälbchen die Flasche. Manchmal stand sie vor der Schule um fünf Uhr früh im Stall. Wenn sie mal einen freien Tag hatten, nahm die Mutter sie mit zum Angeln / Foto © Takie Dela

Valentina prüft ihre Grundangel. Buran wartet ungeduldig auf den ersten Fang / Foto © Takie Dela

Beim Angeln findet Valentina Frieden. Sie hat einige Schicksalsschläge hinter sich. Ihr erster Mann trank. Als der älteste Sohn zehn Jahre alt war, erhängte sich der Vater im Suff. „Ich blieb allein zurück mit drei Kindern“, erinnert sie sich. „Von meinem Lohn und der Hinterbliebenenrente konnten wir kaum leben.“ Da begann sie mit dem Fischen. „Das hat uns Freude gemacht und danach haben wir alle zusammen unseren Fang gegessen.“ / Foto © Takie Dela

Das Warten hat sich gelohnt. Den ersten Fang bekommt Buran. Ihren Teil der Beute nimmt Valentina mit nach Hause. Die kleinen Rotfedern legt sie im Ganzen ein mit Öl, Salz und Gewürzen: „Die musst du nicht einmal putzen. Die garst du sechs Stunden auf dem Herd oder im Ofen, danach schmelzen sie im Mund, sogar mit Gräten.“ / Foto © Takie Dela

Auch der Kater Luntik begleitet Valentina gern beim Angeln. Früher ging sie gemeinsam mit ihren zweiten Ehemann fischen. Seit der sich das Bein verletzt hat, sind Buran und Luntik ihre einzigen Begleiter / Foto © Takie Dela

Valentina nennt den Kater im Scherz die „Fischereiaufsicht“. Die Kiste mit den Angelsachen ist auch Zuhause sein Lieblingsplatz. Draußen auf dem See streicht er Valentina um die Beine und linst ins Eisloch, ob sich da was tut. Im Sommer steigt er zu ihr ins Boot und wartet dann dort, bis ein Fisch am Haken hereingeflogen kommt / Foto © Takie Dela

Nikita und Veronika toben sich nach dem Kindergarten auf dem Sofa aus. Valentina hat ihre Enkel vor drei Jahren zu sich genommen. Das Amt hatte ihrer Mutter – Valentinas Schwiegertochter – das Sorgerecht entzogen, und ihr Sohn kam alleine mit zwei kleinen Kindern nicht zurecht. So wurde die Großmutter noch einmal Mutter / Foto © Takie Dela

Einen typischen Tag beschreibt Valentina so: „Um fünf Uhr stehe ich auf. Ich heize den Ofen ein, mache Frühstück und gucke kurz ins Internet. Dann bringe ich die Kinder in den Kindergarten und gehe fischen. Da kann ich mich entspannen. Wenn ich heimkomme, nehme ich die Fische aus und putze sie. Dann wird gekocht. Wenn die Kinder aus dem Kindergarten kommen, machen wir Hausaufgaben oder spielen. Um zehn gehe ich ins Bett.“ / Foto © Takie Dela
Im Sommer hat Valentina sich einen Traum erfüllt: ein E-Bike. Sie hat lange darauf gespart. Sie sammelt Beeren im Wald und verkauft sie auf dem Markt. Das Rad ist eine Investition: So kommt sie schneller in den Wald an die guten Plätze, wo die Heidelbeeren wachsen.

Nikita und Veronika schauen aus dem Fenster ihres Hauses. Valentina hat ihnen schon gesagt: „Wenn ich einmal sterbe, legt mir eine Angel mit ins Grab.“ / Foto © Takie Dela
Irina Iwanowa und Galina Martynowa, Kinelachta

Irina Martynowa und ihre Mutter Galina Iwanowa breiten ein Netz aus. Der Fischfang hat der Familie geholfen, schwer Zeiten zu überstehen. Galinas Großvater – Irinas Urgroßvater – wurde im Großen Terror erschossen. Seine Frau blieb allein mit fünf Kindern zurück. Um sie satt zu kriegen, begann sie mit der Fischerei. Sie lernte, wie man Netze knüpft, den Zwirn dafür stellte sie aus Leinen selbst her. Früh am Morgen lief sie drei Kilometer zum See und stellte ihre Netze auf / Foto © Takie Dela

Auf der Fahrt über den Sinemuksa-See hat Irina Iwanowna ihren Mann und ihre Mutter im Schlepptau. Seit ihre Urgroßmutter aus der Not mit dem Fischen begann, wird die Tradition von Generation zu Generation weitergegeben / Foto © Takie Dela

Der Tag beginnt mit einem kleinen Barsch. Galinas Großmutter hat ihr beigebracht, wie man Fische fängt. Später hat sie gemeinsam mit ihrem Mann geangelt. Seit er gestorben ist, sitzt sie meistens allein am Wasser / Foto © Takie Dela

Kleine Fische machen auch satt – wenn man genug davon fängt. Früher hat Irina mit ihrer Mutter auch Reusen und Netze aufgestellt, wenn der See gefroren war. Das ist harte Arbeit. Heute wartet Galina meistens zuhause und übernimmt dann das Putzen und die Zubereitung des Fangs / Foto © Takie Dela

Zurück aus der Kälte. Galina Martynowa heizt den Samowar ein / Foto © Takie Dela

Als kleines Mädchen hat Galina gelernt, was Hunger bedeutet. Ihre Großmutter hat die Familie mit den Fischen durchgefüttert, die sie aus dem See gezogen hat. Der Hunger ist Vergangenheit, aber Galina hat immer einen Vorrat im Haus – getrocknet und in der Tiefkühltruhe / Foto © Takie Dela

Der Himmel über dem See / Foto © Takie Dela

Galina Martynowa blickt auf in die Sterne / Foto © Takie Dela
Text & Fotos: Takie Dela
Veröffentlicht am: 11.02.2025