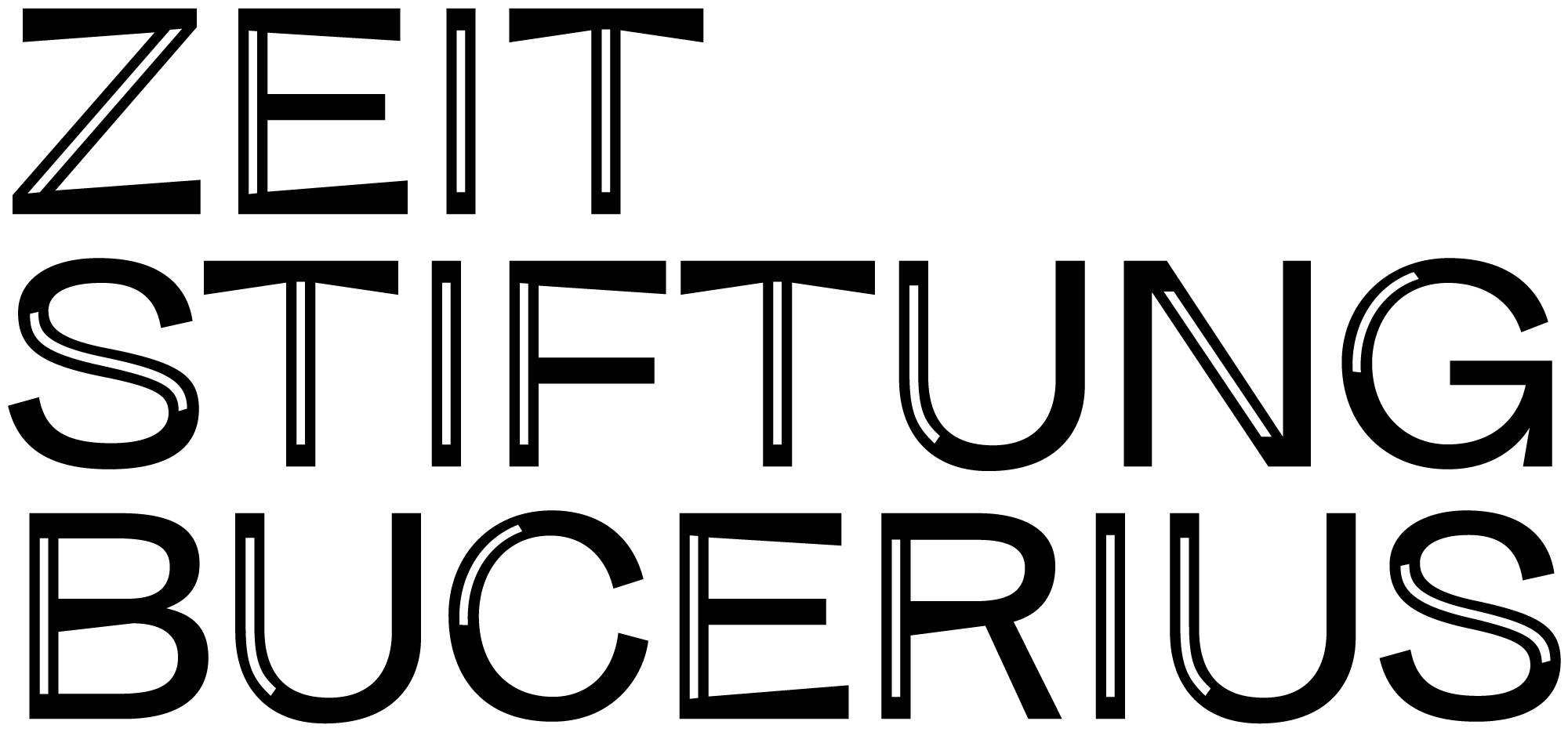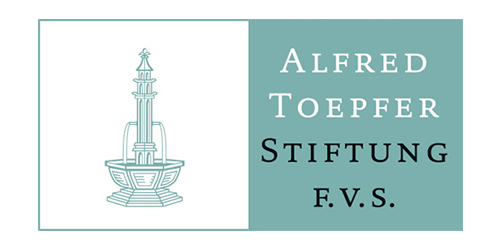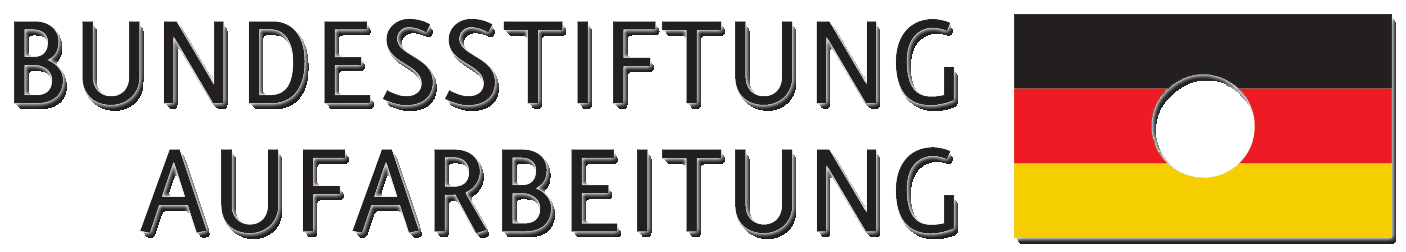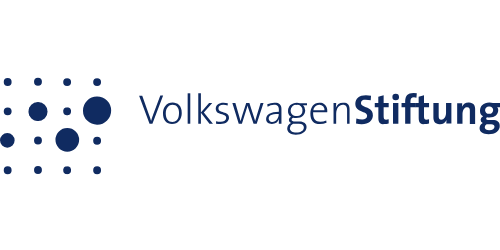Wenn russische Diplomaten vom „nahen Ausland“ sprechen, schwingen viele Bedeutungen mit. Gemeint sind die Staaten, die aus dem Zerfall der Sowjetunion hervorgegangen sind: Sie sind zwar formal unabhängig, doch erhebt Moskau weiter den Anspruch auf Mitsprache. In seiner aktuellen Ausstellung New Fatigue legt der Fotograf Eiko Grimberg offen, wo dieser imperiale Anspruch auch an der Oberfläche sichtbar wird: an Gebäuden und in Städten des ehemaligen Ostblocks, aber auch in öffentlichen Ritualen und Demonstrationen.
Zu Diptychen kombiniert, entfalten Grimbergs Bilder eine zusätzliche Bedeutungs-Dimension. Die Ausstellung mit Fotografien aus drei Jahrzehnten ist noch bis zum 10. Mai in der Galerie K' in Bremen zu sehen:
Galerie K'
Alexanderstraße 9 b / Weberstraße 51 a
28203 Bremen
Weberstraße: Eiko Grimberg
New Fatigue
Alexanderstraße: Arne Schmitt
viel oder wenig Bild oder Text















dekoder: Ihre aktuelle Ausstellung trägt den Titel New Fatigue. Was steckt dahinter?
Eiko Grimberg: New Fatigue spielt auf eine Erschöpfung an, die gerade viele empfinden, und die aus der Flut schlechter Nachrichten resultiert: erst Corona, dann der russische Krieg gegen die Ukraine, der 7. Oktober und der Krieg in Gaza und ganz aktuell US-Zölle und Kurseinbrüche. Die Dichte an Nachrichten ist so hoch, dass man ihr manchmal kaum noch folgen, geschweige denn sie verstehen und verarbeiten kann. Das führt bei vielen Menschen zu einer Ermüdung, man spricht dann von „news fatigue“. In der Ausstellung gibt es ein Video mit dem Titel Journal, das diese Überforderung spürbar macht: eine schnelle Abfolge von Bildern und Videos, die kaum zu verarbeiten ist. Gleichzeitig entsteht daraus aber auch ein Sog, der den Betrachter hineinzieht.
Sie waren bereits in den 1990er Jahren mit Ihrer Kamera in der Ukraine und auch in Russland unterwegs. Jetzt kontrastieren Sie die Bilder von damals mit aktuellen Fotos. Was ist Ihnen dabei aufgefallen?
Mir ging es dabei um die Perspektive von heute auf das Damals. Ich habe mir meine alten Bilder angesehen und mich gefragt, ob man darin vielleicht Hinweise auf die Entwicklungen finden kann, von denen heute einige sagen, man konnte das nicht kommen sehen. Manchmal sieht die Kamera ja Dinge, die wir selbst nicht bemerken und die uns erst später auffallen. Gleichzeitig habe ich dadurch aber auch etwas über mich selbst gelernt und darüber, mit welchem Blick ich nach dem Untergang der Sowjetunion in diese Region gefahren bin.
Und was war das für ein Blick?
Ich würde ihn heute als tendenziell nostalgisch beschreiben. Als junge Männer Anfang 20 aus Westdeutschland haben meine Reisegefährten und ich nach den sichtbaren Manifestationen alles Sowjetischen gesucht. Ich habe die Treppe in Odessa fotografiert, die durch den Sergej-Eisenstein-Film Panzerkreuzer Potemkin weltberühmt wurde, rote Sterne und Stalinbauten. Mit der Perspektive von heute erkenne ich in diesen Monumentalbauten aber noch etwas anderes, nämlich eine imperiale Markierung, die Moskau an Orten hinterlassen hat, die das Regime heute als „nahes Ausland“ bezeichnet und es damit weiterhin als eigene Einflusszone beansprucht.
Moskau hat mit diesen Bauten seinen Einflussbereich also gewissermaßen visuell markiert?
Genau. Ich war im vergangenen Jahr zwei Mal in Warschau. Dort steht ja mitten in der Stadt der Kulturpalast, ein Geschenk der Sowjetunion im Stil des Sozialistischen Klassizismus, auch Zuckerbäckerstil genannt. Und mir ist klar geworden, warum die Polen nach dem Krieg den Wiederaufbau der von der Wehrmacht zerstörten Altstadt so vorangetrieben haben. Die wollten offensichtlich den Sowjets nicht so viel Raum geben. Die hatten sich schon den zentralen Platz direkt am Hauptbahnhof genommen, also guckt man, wie man das begrenzt. Das ist schon eine interessante Entgegnung.
Etwas Ähnliches sehen wir ja in der Ukraine: Dieses Wiederentdecken von nationalen Traditionen, die Suche nach den Wurzeln der eigenen Identität, um nicht eine fremde übergestülpt zu bekommen …
Es gibt noch einen anderen interessanten Trend: In Putins Erzählung ist Stalin stark und Lenin schwach. Lenin wird heute fast ausgeblendet, während Stalin als großer Verteidiger des Vaterlandes wieder gefeiert wird. Damit geht einher, dass die Architektur der Moderne der 1920er und frühen 1930er Jahre nicht besonders pfleglich behandelt wird. Vieles wird abgerissen, wenig steht unter Denkmalschutz. Das ist insofern bemerkenswert, als nicht wenige dieser Modernisten ukrainische Wurzeln hatten. Wladimir Tatlin etwa oder auch Kasimir Malewitsch. Das spielte damals vielleicht keine Rolle. Aber es ist spannend zu sehen, wie diese Künstler je nach politischer Konjunktur eingemeindet oder wieder ausgeblendet werden. Die Internationalität der Sowjetunion dieser Periode wird heute als Schwäche betrachtet.
Mit einem Ort in Moskau haben Sie sich sehr ausführlich beschäftigt: 1931 ließ Stalin die Christ-Erlöser-Kathedrale am Ufer der Moskwa sprengen. Am selben Ort sollte der Palast der Sowjets errichtet werden. Auf dessen Fundament entstand unter Chruschtschow dann ein riesiges Freibad mitten in der Stadt. Und 1995 begann dort der Wiederaufbau der Kathedrale. Was erzählt das über das Land?
Mich faszinierte an diesem Pool, dass er gewissermaßen in einer Falte der Geschichte lag. Er war groß, er war zentral, aber anders als die Sieben Schwestern erstreckte er sich nicht vertikal, sondern horizontal im Raum. Das kreisrunde Bassin Moskwa war ein Sieg über die Natur, weil man dort auch bei Minusgraden im beheizten Wasser das ganze Jahr über schwimmen konnte, umgeben von einer eindrucksvollen Dampfwolke. Fast wie durch Zufall hatte sich die Gesellschaft da etwas Tolles gebaut. Aber dann wurde das sofort wieder verdrängt und zurückgebaut.
Gar nicht weit von dieser Stelle, vor den Mauern des Kreml, steht seit 2016 die Statue des Großfürsten Wladimir. Welche Rollte spielt sie?
Auf die Statue bin ich gestoßen, während ich an dem Projekt über den Pool gearbeitet habe. Ich war zufällig gerade dort, als mit einem Kran das große Kreuz eingehängt wurde. Ich habe das fotografiert, aber mir wurde erst später klar, welcher Wladimir hier eigentlich gewürdigt wird und was das politisch bedeutet. Er schaut ja auf die Kathedrale, er schaut vor allen Dingen aber in die Ukraine, glaube ich. Das war für mich so ein Moment, da dachte ich: Das ist jetzt eine Zäsur. Die Kirche, das war noch Wiederaufbau. Aber hier kommt etwas Neues dazu, was absolut Gegenwart ist und gleichzeitig Anspruch auf eine bestimmte Lesart der Vergangenheit behauptet.
Der russische Deutungsanspruch und das Ringen darum begegnen uns auch hierzulande. Das wird besonders in dem Bilderpaar deutlich, das die Gedenkfeier zum 9.Mai 2022 am sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park und eine Demonstration von Ukrainerinnen im gleichen Jahr zeigt.
Dieses Diptychon ist bewusst konfrontativ gesetzt, ein bisschen polemisch. Da ist einmal diese Riege von Männern in Anzügen, vorne der russische Botschafter Sergej Netschajew mit St. Georgs-Band, dahinter Soldaten und Popen. In der Nähe wurde protestiert von Leuten, die sagten, Russland kann nicht bei uns den Sieg im Weltkrieg feiern, wenn es gleichzeitig Krieg gegen die Ukraine führt. Die zweite Fotografie zeigt geflüchtete Frauen in ukrainischer Tracht, die für mehr Unterstützung für ihr Land demonstrieren. Über den Männern in ihren Anzügen und Uniformen sieht man im Hintergrund diesen metallenen Lorbeerkranz. Die Frauen tragen ein Tarnnetz wie einen Baldachin.
Wenn Sie nochmal an Ihre frühen Bilder von den Reisen von vor 30 Jahren zurückdenken. Könnte man solche Bilder heute noch machen?
Ich würde behaupten, wenn ich heute in Odessa oder in Moskau wäre, dass ich ähnliche Bilder wiederholen könnte. Es gibt große Veränderungen und gleichzeitig eine unheimliche Kontinuität im Stadtbild. Diese stalinistische Architektur war ja auf Dauer angelegt. Aber sie wird von Neuem überlagert. Das ehemalige Hotel Ukraina in Moskau – ebenfalls eine der Sieben Schwestern – steht heute durch die Skyline der modernen Moscow City im Hintergrund in einem neuen Kontext. Diese Schichtungen der Epochen zu zeigen, hat mich immer gereizt.
Fotografie: Eiko Grimberg
Bildredaktion: Andy Heller
Interview: Julian Hans
Veröffentlicht am: 15.04.2025