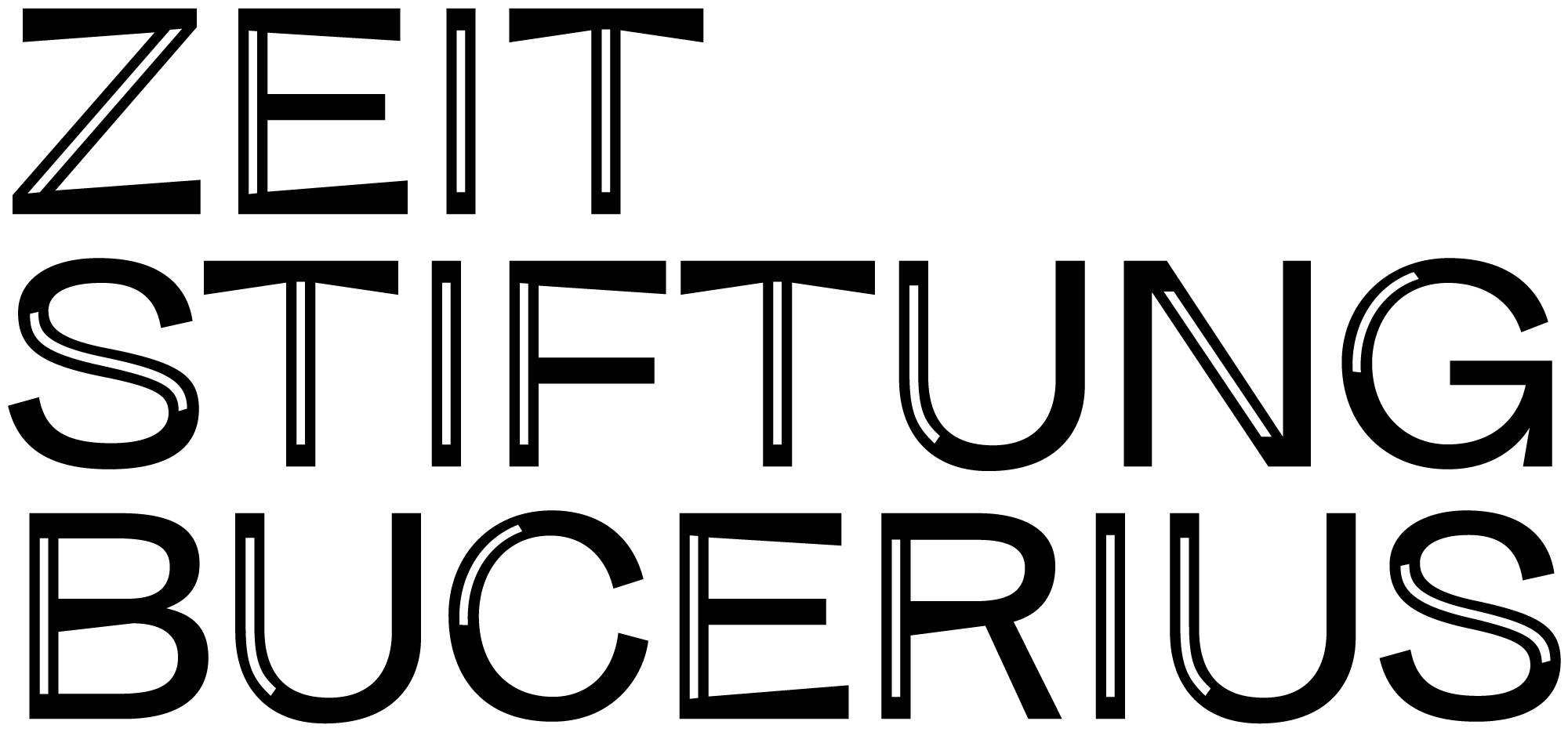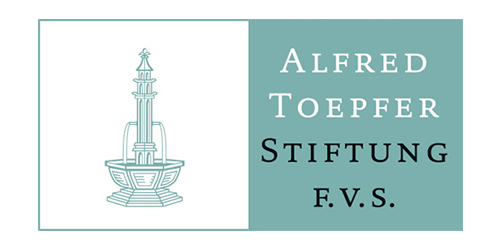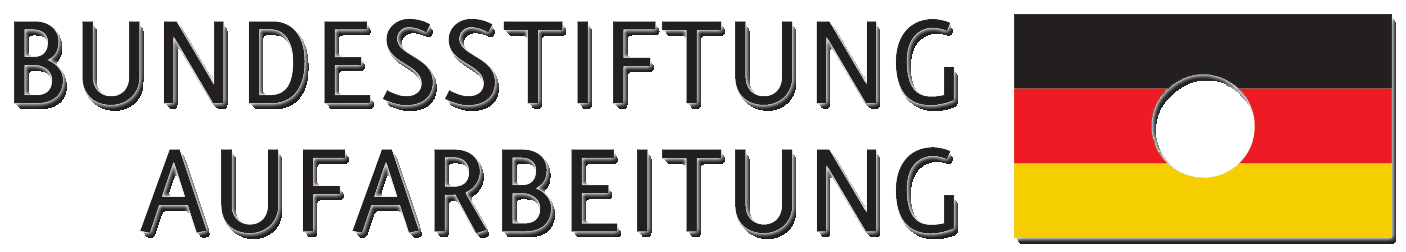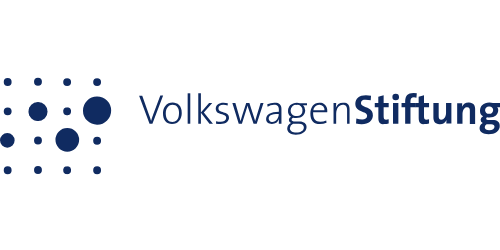Taciana Niadbaj, 1982 in Polazk geboren, ist eine belarussische Lyrikerin und Übersetzerin. 2014 debütierte sie mit dem Gedichtband Sirenen singen Jazz (belarus. Sireny spjawajuz dshas), für den sie mit dem Maxim Bahdanowitsch-Preis ausgezeichnet wurde. Der Einsatz für Menschenrechte und die belarusische Kultur ist immanenter Teil ihres Lebens und Schaffens, genau wie die Auseinandersetzung mit den Folgen russischer imperialer Politik für ihre Heimat. Aktuell steht Taciana Niadbaj dem PEN Belarus als Präsidentin vor, der mit Verfolgung und Repressionen aus dem Land getrieben wurde. Auch sie selbst musste ihre Heimat verlassen und lebt nun in Polen.
In ihrem Essay für unser Projekt Spurensuche in der Zukunft geht sie der Frage nach, was die belarusische Identität für sie und ihr Leben bedeutet und was getan werden kann, um die belarusische Kultur für die Zukunft zu erhalten.

In diesem Text versuche ich zu verstehen, was mich zu der gemacht hat, die ich heute bin. Ich möchte nachvollziehen, woher dieses Gefühl des Belarusischseins kommt, wie es mich trägt und mich vorwärtskommen lässt. Nicht zuletzt möchte ich in meinen Erfahrungen Elemente ausmachen, die anderen bei der Suche und Entfaltung ihrer Identität helfen können. Es sind nicht nur Überlegungen, sondern der Versuch, etwas Größeres zu finden, das für den Aufbau der Kultur und Bildung der Zukunft inspiriert.
Anthropologische Grabungen im Gedächtnis: Der Ursprung
Wenn ich höre, unsere Gesellschaft sei durch und durch russifiziert und alles sei „verloren“, weise ich darauf hin, dass auch ich nicht zwangsläufig hätte Belarusin werden müssen. Ich wuchs nicht in einer belarusischsprachigen Familie auf, wusste unerhört wenig über die Geschichte des Landes, meine Familie pflegte keine explizit belarusischen Traditionen. Man hätte mich ohne Not eine Mankurtin und Renegatin nennen können – und einen Schlussstrich setzen. Was hat mich also zur Belarusin gemacht? Was nährte in meiner Kindheit und Jugend in mir ein Gefühl des Belarusischseins?
In der fünften Klasse wurden an meiner Schule zwei Klassen mit Belarusisch als Unterrichtssprache gebildet – die c und die d. Die Klassen a und b blieben russischsprachig. Ich erinnere mich kaum an die damaligen Diskussionen in der Familie, mit den Kindern wurde ohnehin nichts besprochen, aber aus den herumfliegenden Argumenten blieb bei mir hängen, dass man mit einem solchen Schulabschluss nicht an der Universität studieren könne, da es keine Universitäten mit Belarusisch als Unterrichtssprache gab.
Überhaupt kann ich mich nicht entsinnen, dass in unserer Familie über Nationalitäten gesprochen wurde. Wie fern mir dieses Konzept lag, zeigte sich gleich in mehreren Situationen.
In der Musikschule wurde ich einmal gefragt (es musste wohl in einem Formular eingetragen werden), welche Nationalität ich habe. Ich war verwirrt – ich wusste die Antwort nicht.
Die zweite Situation trug sich in der Sonntagsschule zu, die meine Klassenkameraden besuchten. Sie hatten mich eingeladen mitzukommen: Man lernte eine Sprache (Hebräisch, warum auch nicht), Tänze und Lieder. Manchmal wurde ich dort gefragt, ob es in meiner Familie Juden gäbe, und ich verneinte unsicher. Bei der Aufführung zum Purim-Fest gab man mir die Rolle des Haman: Im entscheidenden Moment musste ich betrunken wirken und mit dem Gesicht in den Salat fallen. Ich erfüllte den Auftrag gewissenhaft, obwohl ich die Bedeutung dieser Szene damals nicht verstand. Erst Jahre später wurde mir die Komik der Situation bewusst.
Nationalität war für mich lange Zeit keine Kategorie von Bedeutung.
Gleichzeitig drängte das Nationale aus den Lehrbüchern für belarusische Literatur ungestüm in den Raum. Und überzeugte nicht. Man hatte das Gefühl, es sei salonfähig und korrekt, Belarus zu lieben ... Die 1990er waren voll mit der Rhetorik von „Wiedergeburt“ und „bewussten Belarusen“, aber das fand keine Resonanz. Das aus den Narrativen der Literaturlehrpläne hervorschwellende Pathos, „das harte Leid des Bauern“ und „die Arbeit auf der Scholle“, war mir fremd. Die erhabenen Worte von der Heimat flogen hoch oben vorbei, setzten sich kurz – wie Zugvögel auf Stromleitungen – auf die Zeilen der Schulaufsätze, nur um sofort wieder aus dem Blick zu verschwinden, sobald eine gute Note erteilt worden war. Dann kam die Zeit der Rebellion, in der wir unsere Lehrer fragten: Warum ist Belarusisch unsere Muttersprache, wo wir doch unsere ersten Worte auf Russisch gesagt haben? Die Schule bewirkte also eher eine Ablehnung des Belarusischen.
Wie bereits erwähnt, gab mir auch meine Familie keinen Rahmen für die Herausbildung einer nationalen Identität vor, obwohl in den Pässen meiner Eltern (und auch ihrer Eltern) formal eine Nationalität eingetragen war – Russen und Ukrainer. Weiter östlich als Brjansk und Smolensk sind meine Vorfahren meines Wissens aber nie gekommen. Die Situation mit den ukrainischen Verwandten ist klarer (sie waren auf ukrainischem Territorium verwurzelt), die „Russischen“ bleiben – für mich jedenfalls – ein Rätsel.
Ich bin indes in Polazk geboren. Diese Stadt lockt und leitet einen natürlich in ein spezielles Koordinatensystem, aber mein Lokalpatriotismus war nicht sonderlich mit der nationalen Identität verbunden. Wenn ich ehrlich mit mir bin, dann weiß ich: Weder der geografische Geburtsort meiner Vorfahren noch mein eigener haben große Bedeutung, solange ich sie ihnen nicht selbst gebe. Zudem gibt es genügend Beweise für das Gegenteil: Menschen, die „hier geboren“ sind, können sich als Subjekte anderer Ideen und Projekte betrachten.
Nichts schien also auf meine belarusische Vorbestimmung hinzudeuten – weder die Familie, noch die Schule, noch der Geist der ersten Hälfte der 1990er und die Belarusifizierung. Und doch wählte ich Ende der 1990er (als es schon gar nicht mehr im Trend lag) ganz bewusst das Belarusische.
Belarusischsein als bewusste Entscheidung
Irgendwann habe ich einmal gesagt, dass mich die Freundschaft zu Belarus gebracht hat. Das ist einerseits wahr, andererseits auch eine gewisse Vereinfachung: Menschen kommen und gehen, und die Ideen, die mit ihnen verbunden sind, müssen sich nicht festsetzen. Es braucht auch eine Umgebung, die dich mit ihrer Metaphysik verführt, mit der du dich identifizieren willst, sie ist fraglos der Nährboden, der – wie in Maxim Bahdanowitschs Sonett – die „Lebenskraft spendet, die Ähren üppig sprießen lässt“, bis es schließlich schon „kein Halten mehr gibt“. Es ist wie an Heiligabend, wenn die Weihnachtssänger an dein Fenster klopfen, du mit ihnen gehst und mit jeder einzelnen Pore die Magie spürst. Als würde man Mietwohnungen, Hostels und Hotelzimmer endlich gegen einen konkreten Ort eintauschen, an dem man sich nicht nur zu Hause fühlt, sondern auch verantwortlich für die Ordnung (oder eben Unordnung), zu der man als Subjekt und Eigentümerin mit den eigenen Händen beiträgt. Die belarusische Identität entbrennt in dir wie ein Stern, zusammen mit diesem Gefühl der Verantwortung – für das Getane und das Nicht-Getane.
Mit dieser Entscheidung zu leben ist dann gar nicht so einfach. Du kommst an einen Punkt, an dem du dieses Belarusischsein einfach als stabilen und wichtigen Teil deiner Identität haben willst – nicht als Flagge oder Transparent, und schon gar nicht als etwas, das verteidigt werden muss (für das Eigene einzustehen ist nicht schlimm – aber warum muss man dieses Recht denn erst erkämpfen, kann man nicht einfach sein, wer man will?). Du willst deine Sprache einfach als Kommunikationsmittel nutzen, ohne in der Kleinstadt zu einer Figur zu werden, der immer irgendjemand sagt, „wie schön du Belarusisch sprichst“, ein anderer wiederum sagt „sprich normal“, und noch ein anderer deine Fehler korrigiert und dir rät, erst einmal die Sprache richtig zu lernen, bevor du beginnst sie zu sprechen. Ich träume davon, dass eine Zeit kommt, in der Belarusisch auf unseren Straßen kein Aufsehen mehr erregt.
Weiter oben habe ich mir närrische Aussagen über das Pathos der belarusischen Literatur erlaubt – heute weiß ich natürlich, dass die Menschen für die Möglichkeit, Belarusen sein zu können, gestorben sind. Heute schätze und ehre ich die Erfahrung und die Errungenschaften der vorangegangenen Generationen, als deren Fortführung ich mich verstehe. Aber ich weiß auch, dass mich nicht der Lehrplan für belarusische Literatur (in dem genügend ehrenvolle Autoren und Werke vertreten sind) zu dieser Erkenntnis gebracht hat, sondern Freunde, Mitstreiter und Kollegen, die eine Matrix geschaffen haben. Schließt man sich ihr an, begreift man auch das unansehnliche schulische Literaturprogramm als etwas Eigenes, ebenso wie das, was nicht darin vorkommt. Man lernt dazu, begeistert sich und aktiviert in sich diese Möglichkeit – Belarusin zu sein. Du wirst Teil dessen, was vor dir da war, was es dir ermöglicht hat, heute so zu sein, wie du bist, und es das Eigene zu nennen. Du beginnst, in diesem Spiegel dein Abbild zu sehen, das du vorher nicht wahrgenommen hast.
Wir registrieren aktuell eine hohe Zahl an Verletzungen der kulturellen Rechte: die Vernichtung der belarusischen Kultur, die Einengung des Raumes, in dem die belarusische Sprache genutzt werden kann, sogar zusätzliche Repressionen und Folter für Belarusischsprechende. Dieser Zustand ist furchtbar und inakzeptabel. Aber ich blicke optimistisch in die Zukunft und bin sicher, dass wir auch unter den heutigen, ungünstigen Bedingungen überleben werden. Nicht nur deshalb, weil man uns bislang nicht erschießt (das könnte ein trauriger Witz sein, würden in den Gefängnissen nicht unsere Mitstreiter an den Repressionen sterben). Unsere Sache mag manchmal hoffnungslos erscheinen, aber tatsächlich sollten wir sie als Erfahrung der Unzerstörbarkeit und des unwahrscheinlichen Überlebens betrachten: Es scheint uns nicht zu geben, und doch – hier sind wir. Was uns nicht tötet, macht uns unsterblich.
Von Zeit zu Zeit beginnt ein neuer Zyklus, neue Anhänger kommen dazu. Diese Anfangszeit des Belarusischseins hat ohne Frage auch Nachteile: Wo man sich auf die Erfahrung der Vorgänger hätte stützen und das Wachstum schon auf einer bestimmten Höhe fortführen könnte, begreifen sich die Neulinge als Indexpatienten und beschreiten den Weg von Anfang an, holen sich Beulen, die mit dem Wissen der Vorgänger hätten vermieden werden können. Andererseits hat auch das Vorteile: Die Gewissheit verleiht der Entscheidung Sinn, stärkt die Beharrlichkeit. Nichts von den Niederlagen und Misserfolgen zu wissen, befördert Mut und Kühnheit – und das ist sehr hilfreich für das Fortkommen der Bewegung (vor allem, nicht zu denken, die Situation sei kompliziert und aussichtslos).
Wenn ich sage, dass das Belarusischsein unter unseren Gegebenheiten oft eine bewusste Entscheidung ist, erzähle ich gern die Geschichte von den Volkszählungen. Im Jahr 2019 bezeichneten 54 Prozent das Belarusische als ihre Muttersprache, 26 Prozent gaben an, Belarusisch zu sprechen (zum Vergleich: bei den Erhebungen 1999 und 2009 nannten 73 Prozent resp. 53 Prozent Belarusisch ihre Muttersprache, und 37 Prozent resp. 23 Prozent gaben an, Belarusisch zu sprechen). Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass 2019 jeder Vierte in unserem Land Belarusisch gesprochen hat – wenn es doch nur so wäre! Aber ich kann mir gut vorstellen, wie diese Konstruktion der Wirklichkeit zustande kommt: Die bewusst gewählten Antworten bei der Volkszählung sind Ausdruck der zivilgesellschaftlichen Position, eine Erklärung urbi et orbi, worauf es ankommt.
Wenn ich von der Aussichtslosigkeit der Sache spreche, weise ich darauf hin, dass 2020 nicht aus heiterem Himmel geschah, es wäre nicht möglich gewesen ohne die stete Vorarbeit der Zivilgesellschaft, darunter auch der kulturellen Projekte und Initiativen (selbst wenn die Neulinge von 2020 den Eindruck haben mögen, dass vorher alles falsch gemacht wurde). Ich erinnere mich gut an die Aktionen für Unabhängigkeit Ende 2019, als einige Dutzend Menschen mit weiß-rot-weißen Fahnen durch Minsk zogen. Ich erinnere mich an den Unwillen der demokratischen Kandidaten bei der Präsidentschaftswahl 2020, die weiß-rot-weiße Flagge zu benutzen. Und ich erinnere mich an den 16. August 2020, als ganz Minsk in Weiß-rot-weiß erstrahlte. Was das Regime heute mit unserer Flagge (und ihren Anhängern) macht, verstärkt nur das symbolische Gewicht und die Bedeutung der Flagge in der Zukunft. Bis dahin werden wir unsere tägliche Arbeit weiterführen.
Mein persönlicher Weg zur belarusischen Identität zeigt, wie wichtig es ist, Bedingungen zu schaffen, unter denen Menschen diese Entscheidung bewusst und rational treffen, und sie dann auch beibehalten und festigen können.
Oft ergeben sich Diskussionen darüber, ob die Belarusifizierung in den 1990ern erzwungen war – oder ob das nur ein Mythos ist, der zur Abschreckung dient. Ohne Gespräche darüber fallen auch Überlegungen schwer, wie die Zukunft aussehen könnte, wenn in Belarus demokratische Änderungen anstehen. Die Geschichte von der weiß-rot-weißen Flagge beweist meiner Ansicht nach eines: Der Staat muss einfach nur die Zügel lockern und nicht eingreifen – dann richtet sich alles mit der Zeit von selbst ein.
Die Förderung und Entwicklung der belarusischen Kultur muss natürlich auch durch die staatliche Politik erfolgen, und so denke ich mit Schrecken an unser Bildungssystem und die Ideologisierung der Kultursphäre. Ich vertraue nur in geringem Maße auf die Fähigkeit der aktuellen Beamten im Bildungs- und Kulturbereich, attraktive Lehrpläne gestalten zu können, die die Schülerinnen und Schüler nicht von der nationalen Kultur abschrecken. Das Problem liegt nicht darin, dass es keine entsprechenden Materialien gäbe (die gibt es), sondern in der Verknöcherung des Behördendenkens und überhaupt im niedrigen Niveau der humanistischen Bildung, das nicht so schnell zu beheben sein wird.
Als Ausweg für die Zukunft – auf diese Weise wird kein Zwang notwendig sein – sehe ich die finanzielle Unterstützung (Projektförderung) unabhängiger Kultur- und Bildungsinitiativen durch den Staat. Der Kulturhaushalt sollte also weniger in die Programme des Kultusministeriums fließen, sondern stärker an nichtstaatliche Initiativen gehen, denen es auch vor 2020 den Bedingungen zum Trotz gelang, das Feld der belarusischen Kultur reichhaltig, spannend, attraktiv und inspirierend für alle zu gestalten, die sich dieser Matrix anschließen wollten. Meiner Ansicht nach sollten dabei Projekte priorisiert werden, die auf die Bildung von Gemeinschaft und horizontalen Netzwerken abzielen und eine starke Werteorientierung aufweisen.
Zwei Beispiele
Ich möchte an dieser Stelle zwei positive Beispiele beschreiben, die konkret für meine persönliche und professionelle Entwicklung und meine Integration in die Berufswelt nicht weniger wichtig waren als die schulische und universitäre Bildung: Im Bereich der Literatur waren das die Werkstätten (Wettbewerbe) für junge Literaten. Im Bereich der Menschenrechtsarbeit – und weiter gefasst, eines Ansatzes, der auf den Menschenrechten als handlungsleitender Maxime beruht – war es die Belarusische Menschenrechtsschule. Ich bin überzeugt, dass viele, die heute eine zentrale Rolle in der belarusischen Bewegung spielen, ähnliche Seminare, Kurse und Projekte nennen können, die sie in den Orbit zogen und Wachstum und Aktivität ermöglichten. Ich beschreibe hier also zwei Beispiele unter vielen, weil sie für mich persönlich eine Schlüsselrolle spielten.
Die Wettbewerbe für junge Literaten waren drei- bis fünftägige Werkstätten, die der PEN Belarus zwischen 2000 und 2010 ausrichtete. Man stelle sich vor: Aus dem ganzen Land kamen zwei Dutzend junge Autoren und Autorinnen zusammen, die einander in der Regel noch nicht kannten und die älteren Kollegen auch nur vom Namen her. Für ein paar Tage vertiefen sich diese zwanzig Anfänger und die Riege der Meister völlig in die Literatur – Lyrik, Prosa, Übersetzung. Sie besprechen die vorab geschriebenen und für den Wettbewerb eingereichten Werke, geben einander praktische Ratschläge, es gibt Vorträge über Literaturgeschichte und die aktuelle Situation, es werden praktische Aufgaben gestellt, deren Ergebnisse ebenfalls präsentiert und diskutiert werden. Dieser Cocktail (andere Cocktails gibt es übrigens auch) gemischt mit dem informellen Austausch an den Abenden bis zum Morgengrauen, gibt nicht nur einen riesigen Schaffensimpuls, sondern integriert die Nachwuchsautoren auch in die literarischen Kreise, macht sie miteinander bekannt, schafft kreative, professionelle und freundschaftliche Verbindungen. Ich glaube, es ist vergleichbar mit einer Gruppe Absolventen einer guten Universität nach Jahren des gemeinsamen, anspruchsvollen Studiums.
Die Belarusische Menschenrechtsschule ist eine seit 2006 bestehende Bildungs- und Aufklärungsinitiative. Sie legt ein Wertefundament und vermittelt praktisches Wissen im Bereich der Menschenrechte. Mehrere Stufen der Ausbildung – Anfänger bis Fortgeschrittene – fördern mit einem Mix aus verschiedenen Formaten und Methoden, den Grundbestandteilen des nonformalen Lernens und der Kommunikation, nicht nur die Bildung der Teilnehmenden, sondern auch die Integration neuer Aktivisten und Aktivistinnen in die Zivilgesellschaft, ihr Kennenlernen untereinander und den Austausch mit erfahrenen Menschenrechtsaktivisten und Experten. Das Programm beruht auf einer soliden Wertebasis, vermittelt Wissen, das mit einem praxisorientierten Ansatz auf Schutz und Verteidigung der Rechte abzielt. Die Experten der Schule sind Vertreter der wichtigsten belarusischen Menschenrechtsorganisationen, was das Projekt und seine Erfolge zu einer gemeinschaftlichen Errungenschaft macht. Der menschenrechtsbasierte Ansatz ist nicht nur für Menschenrechtsschützer verpflichtend, sondern muss allen demokratisch orientierten Aktivitäten zugrunde liegen. Die Absolvent:innen dieser Intensivkurse werden also zu Trägern von Wissen, Kompetenzen und eines Wertegerüstes, die in allen Bereichen des gesellschaftlichen Engagements nützlich sind.
Ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass meine Tätigkeit beim PEN Belarus heute in weiten Teilen der Teilnahme an den PEN-Seminaren für Literaten zu verdanken ist. Die Menschenrechtsschule gab mir einen starken Start in die Arbeit als Menschenrechtsaktivistin. Die zukünftige Kultur- und Bildungspolitik muss daher meiner Überzeugung nach auf die Unterstützung solcher Projekte hinarbeiten, um Interesse für die belarusische Kultur zu wecken und ein menschenrechtsbasiertes Wertegerüst für jede Form des Engagements zu schaffen. Bis dahin müssen diese und andere Initiativen für die belarusische Zivilgesellschaft mit Unterstützung externer Geldgeber aufrechterhalten werden.
Schlussbetrachtung
Natürlich gibt es Familien, in denen die Kinder von Geburt an mit dem Belarusischsein aufwachsen, aber das ist nicht der einzige Weg. Wenn man keine belarusischsprachige Familie hat, kann das Umfeld die Möglichkeit geben, bezüglich der Sprache eine Entscheidung zu treffen, sie beizubehalten und auszubauen. Belarusischsein – das ist nicht nur etwas, das weitergegeben wird, sondern auch etwas, das bewusst gewählt wird, um Teil von etwas Größerem als man selbst zu sein. Es ist eine Entscheidung, die die Zukunft prägt.
Jeder neue Mensch, der das Belarusischsein wählt, macht sich zum Teil einer großen Geschichte, die auch unter den schwierigsten Bedingungen nicht abbricht. Diese Entscheidung kann er aber nur treffen, wenn es Unterstützung und Nährboden für Wachstum und Entwicklung gibt. Wir schaffen diesen Boden durch unsere tägliche Arbeit: durch Kultur, Bildung, Gemeinschaft. Diese Arbeit geschieht vielleicht unauffällig, aber sie sichert eine Zukunft, in der das Belarusischsein keine Ausnahme mehr sein wird, sondern die Norm.
Belarusischsein bedeutet heute nicht nur eine Entscheidung, sondern auch eine Verantwortung. Dafür, dass das vor uns Erreichte nicht verlorengeht, dass unsere Bemühungen zum Fundament für die nachfolgenden Generationen werden. Belarusischsein – das ist wie ein Feuer, das man nicht nur entzünden, sondern auch weitergeben muss. Und es ist kein Feuer der Auflehnung, sondern des Aufbaus, das selbst dann noch brennen wird, wenn ringsum nur noch Dunkelheit zu herrschen scheint.
Stark können wir nur zusammen werden. Belarusischsein ist keine Sache einer Einzelperson, sondern die einer Gemeinschaft, die den Menschen hilft, sich in dieser Welt zu finden. Wir brauchen einander, die Unterstützung und die Mitarbeit, damit jedes Jahr mehr Menschen fühlen, dass Belarus nicht nur ein Land ist, sondern ein Zuhause, das wir alle gemeinsam bauen.
Die aktuellen Rahmenbedingungen mögen ungünstig erscheinen, aber ich glaube daran, dass die Zukunft der belarusischen Kultur von uns abhängt. Von unserer Fähigkeit zu träumen, zu arbeiten und uns treu zu bleiben. Die Geschichte hat mehr als nur einmal gezeigt: Was wahrhaftig und lebendig ist, findet immer einen Weg zu bestehen. Und so wird Belarus seinen Weg finden, dank uns und allen, die nach uns kommen werden.
Anmerkung der Redaktion
Weißrussland oder Belarus? Belarusisch oder belarusisch? Die Belarus oder das Belarus? Nicht ganz leicht zu beantworten. Da es im Deutschen keine einheitlich kodifizierten Schreibweisen für diese Bezeichnungen und deren Adjektive gibt, überlassen wir es den Autorinnen und Autoren welche Schreibweise sie verwenden. Die Schreibweise in redaktionellen Inhalten (wie Titel und Erklärtexte) wird von der dekoder-Redaktion verantwortet.