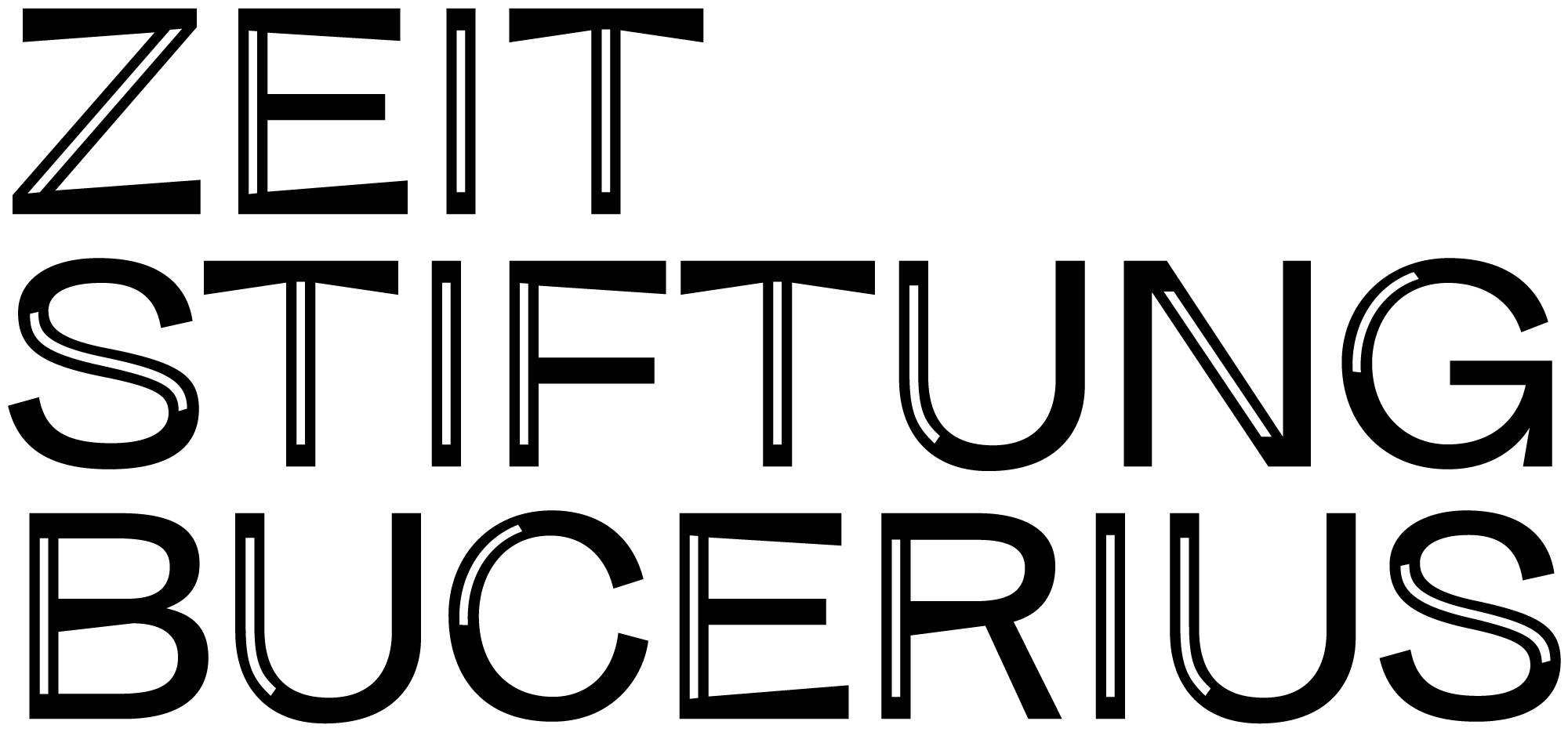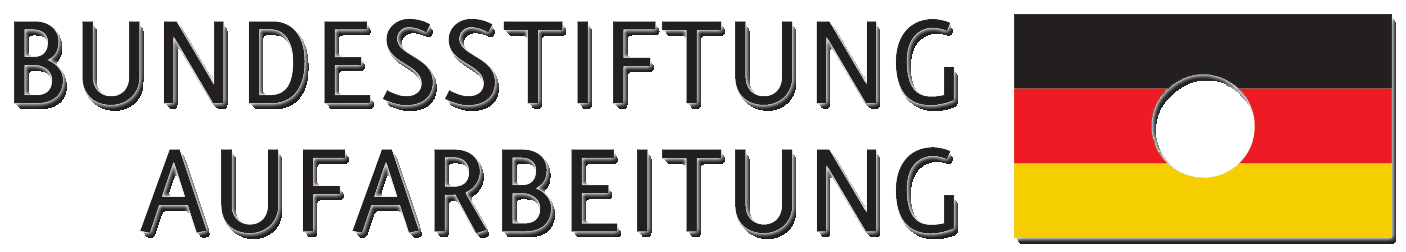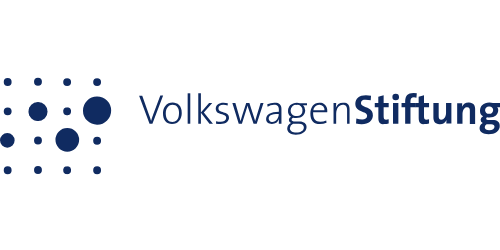Am 8. Dezember 2018 ist Ljudmila Alexejwa mit 91 Jahren verstorben. Sie galt als Grande Dame der russischen Menschenrechtsbewegung. Was machte sie so einzigartig? Einen Überblick über ihr Leben und Wirken gibt Maike Lehmann – in fünf Fragen und Antworten.
1. Am Samstag ist Ljudmila Alexejewa verstorben, die Grande Dame der russischen Menschenrechtsbewegung. Was für ein Mensch war sie?
In gewisser Hinsicht war Ljudmila Alexejewa eine typische Vertreterin ihrer Generation. Aufgewachsen in den 1930er und 1940er Jahren, war sie eine junge Stalinistin bis sie nach der Geheimrede Chruschtschows 1956 in ihrer Parteizelle den stalinistischen Terror erklären musste.
Aber während sich Altersgenossen in der neuen sowjetischen Konsumgesellschaft einrichteten, beteiligte sich Ljudmila Alexejewa in den 1960er und 1970er Jahren an der Dokumentation staatlicher Repressionen. Sie organisierte außerdem die Unterstützung der Familien von Inhaftierten, trotz mehrerer Verhöre durch den KGB.
Nachdem sie 1976 die Moskauer Helsinki Gruppe mit begründet hatte, wurde sie ins Exil gedrängt, setzte aus den USA aber ihre Informationsaktivitäten zu Menschenrechtsverletzungen in der Sowjetunion fort und erklärte dem Westen zugleich die Dissidentenbewegungen.2. Was machte Ljudmila Alexejewa so einzigartig?
Was sie von ihren MitstreiterInnen unterschied, war ihre besondere Fähigkeit, zwischen Ost und West zu übersetzen, mit soviel Bestimmtheit wie Humor und ohne viel Aufhebens um ihre eigene Person. Sie verstand im besonderen Maße wie Aufmerksamkeit in den Medien dem Kampf für Menschenrechte dienlich sein konnte. Zugleich gehörte sie zu den wenigen exilierten DissidentInnen, die nach 1991 nach Russland zurückkehrten und dort ihre Arbeit fortsetzten.
Trotz nachlassender Gesundheit nahm sie bis vor wenigen Jahren an Demonstrationen teil, reiste um die Welt, schuf durch konsistente Anwesenheit bei den öffentlichen Sitzungen des Polizeikonzils eine effektive Plattform zur Verteidigung der Rechte von verhafteten Demonstranten. Und sie scheute sich zugleich nicht, im Menschenrechtsrat der Regierung mitzureden und -zustreiten, ob es nun um den Tschetschenienkrieg, das Agentengesetz oder die Versammlungsfreiheit ging.
Einzigartig war auch ihre Bereitschaft über die Jahre, mit allen zu reden, beharrlich in ihren Grundsätzen, witzig und pointiert, mit viel Hoffnung für die junge Generation, aber auch ohne große Illusionen über die Schwierigkeiten zivilgesellschaftlichen Engagements in Russland.3. Ljudmila Alexejewa war zu Sowjetzeiten Mitbegründerin der Moskauer Helsinki Gruppe. Was war das für eine Organisation?
Die Moskauer Helsinki Gruppe wurde 1976 gegründet, nachdem die KSZE-Schlussakte in Helsinki unter anderem die Achtung der Menschenrechte samt der Gedanken- , Überzeugungs-, Religions- und Meinungsfreiheit völkerrechtlich für alle Unterzeichnenden und somit inklusive der Sowjetunion festlegte. Die Gründungsmitglieder waren Dissidenten und Menschrechtsaktivisten, die schon zuvor in unterschiedlichen Konstellationen die Verletzung der sowjetischen Verfassung und Gesetzgebung durch Gerichte, Geheimdienst und Miliz dokumentiert und international publik gemacht hatten.
Mit Helsinki gab es nun eine internationale Rechtsnorm, deren Nichteinhaltung durch den sowjetischen Staat neben der Moskauer auch Helsinki Gruppen in der Ukraine, dem Baltikum und im Kaukasus dokumentierten. Letztere hatten aber keinen vergleichbaren Zugang zu internationalen Medien wie die Moskauer Helsinki Gruppe. Nach Verhaftungen und Exilierung der Mitglieder stellte die Moskauer Helsinki Gruppe 1982 ihre Aktivitäten ein.4. Und was macht die Moskauer Helsinki Gruppe heute?
1989 kam es zu einer Neugründung der Gruppe, die sich seither weiterhin für die Wahrung von Menschenrechten und Versammlungsfreiheit einsetzt. In den 1990er Jahren erhielt die Gruppe Büroräume auf Anweisung von Präsident Jelzin, was damals als Ausweis des Prestiges der Gruppe gesehen wurde.
Angesichts des Agentengesetzes von 2012 entschied sich die Moskauer Helsinki Gruppe dafür, ausländische Finanzquellen aufzugeben, um ihre Menschenrechtstätigkeit zumindest im eingeschränkten Rahmen fortsetzen zu können. Dennoch setzt die Gruppe ihre Kritik an der staatlichen Politik fort, nicht zuletzt am Agentengesetz. So trat Ljudmila Alexejewa aus Protest gegen die Wiederwahl Putins aus der Menschrechtskommission 2012 zurück, kritisierte 2014 die Besetzung der Krim, um dann 2015 wieder einen Sitz in der Menschenrechtskommission des Präsidenten zu übernehmen, um hier die Stimme der Nichtregierungsorganisationen hörbar zu machen.5. Putin honorierte nun ihre Verdienste für die Zivilgesellschaft, war auf ihrer Trauerfeier. Wie war das Verhältnis der beiden zueinander?
Ljudmila Alexejewa hat Putin wiederholt für seine Politik kritisiert, sei es in Tschetschenien, in der Ukraine, in Bezug auf seine dritte Wahl zum Präsidenten, die Einschränkung der Versammlungsfreiheit und die politische Atmosphäre, die die Regierung nach Beginn des Krieges in der Ostukraine im Land schürte.
Als Putin sie zu ihrem 90. Geburtstag besuchte, nutzte sie die Gelegenheit, ihn um die Amnestierung von Igor Ismestijew zu bitten, einen ehemaligen Senator, der 2007 wegen Mordes angeklagt und verurteilt wurde, wofür nach Ansicht seiner Anwälte keine ausreichenden Beweise präsentiert wurden.
*Das französische Wort Bistro stammt angeblich vom russischen Wort bystro (dt. schnell). Während der napoleonischen Kriege sollen die hungrigen Kosaken in Paris den Kellnern zugerufen haben: „Bystro, bystro!“ (dt. „Schnell, schnell!“) Eine etymologische Herleitung, die leider nicht belegt ist. Aber eine schöne Geschichte.
Text: Maike Lehmann
Stand: 12.12.2018