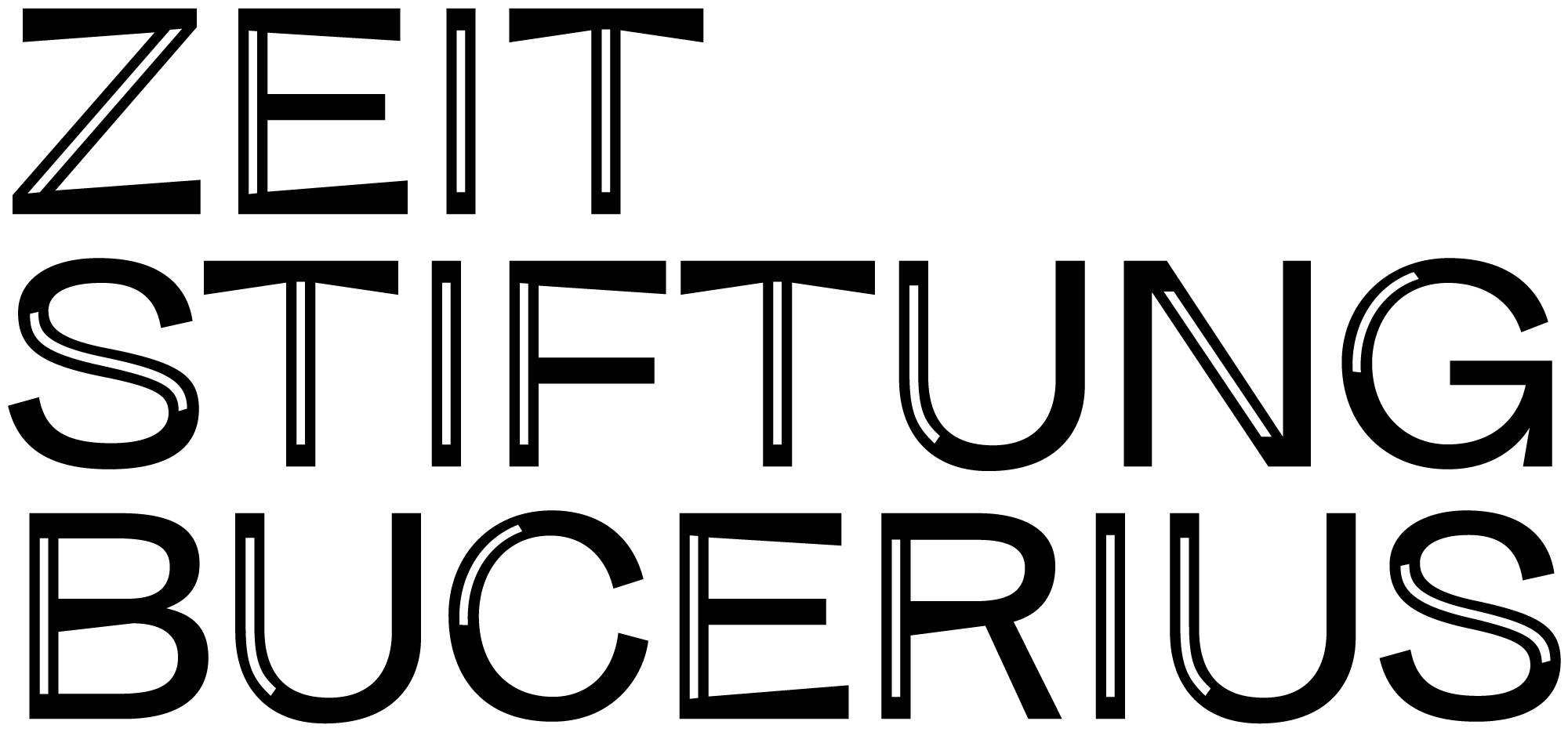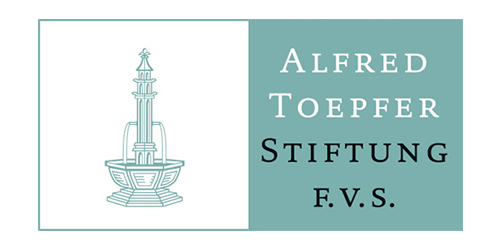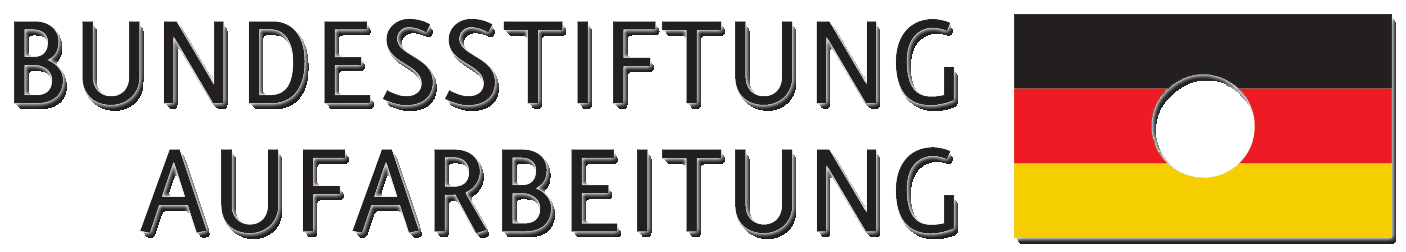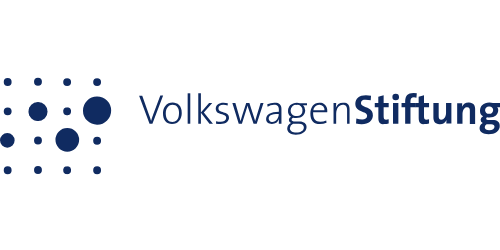Als „Vaterländischer Krieg“ ging Napoleons gescheiterter Feldzug gegen Russland im Jahr 1812 in die russische Geschichtsschreibung ein. Er nimmt im kollektiven Gedächtnis Europas den Platz im 19. Jahrhundert ein, der dem Zweiten Weltkrieg im 20. Jahrhundert zufällt. Im russischen Geschichtsbewusstsein stehen „Vaterländischer Krieg“ und „Großer Vaterländischer Krieg“ in einem engen symbolischen Zusammenhang: Zweimal wurde eine existentielle Bedrohung des Staates durch eine beispiellose Kraftanstrengung der „Nation(en)“ abgewehrt. Schier übermächtige, von Erfolgen verwöhnte Streitkräfte aus Kontingenten verbündeter europäischer Mächte, die Grande Armée oder die nationalsozialistische Wehrmacht, werden nahezu aufgerieben. Russische Truppen ziehen in Paris beziehungsweise Berlin ein.

Der Krieg von 1812 wird in der Erinnerung mit spekatulären Schlachten in Verbindung gebracht, wie der „entscheidenden Schlacht“ bei Bordino (Louis Lejeune, 1822)
Zwei Katastrophen unvorstellbaren Ausmaßes, zwei verheerende Niederlagen beziehungsweise zwei glänzende Siege ergeben aber noch keine eindeutige Geschichte. Hohe Verluste waren auf beiden Seiten zu beklagen, Prestigegewinn und Machtzuwachs hielten sich die Waage mit neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen.
Das ambivalente Erbe des Krieges
Ambivalent war das Erbe von 1812 schließlich auch deshalb, weil sich hier die Wasser teilten. Das „Vaterland“ verteidigten nicht allein Russen, sondern Angehörige anderer Ethnien des Vielvölkerreiches, nicht zuletzt die Bewohner der belarussischen und ukrainischen Lande. Wie im übrigen Europa erfasste sie alle das Gefühl nationaler „Erweckung“. Wie ein Lauffeuer erfasste dieser außerordentliche Krieg den etablierten Kulturbetrieb, die Folklore, die Historiographie und das politische Denken. Maler, Musiker, Dramatiker, Dichter, Romanciers, Bildhauer und Regisseure wurden in 200 Jahren nicht müde, ihn stets aufs Neue nachzugestalten und zum emotionalen Erlebnis zu machen. Die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum im Jahre 1912 bedeuteten kein Ende des Booms. Selbst heute, über 200 Jahre später, hat der gescheiterte „Marsch auf Moskau“ nichts von seiner suggestiven Ausstrahlung eingebüßt, nicht zuletzt deshalb, weil Hitler das vergebliche „Husarenstück“ wiederholte.
Es war der erste Krieg seit zwei Jahrhunderten, den Russland auf eigenem Territorium führen musste. Es war ein Krieg, der durch spektakuläre Rückzüge der russischen Armee bis in die Tiefe des Landes hinein geführt wurde. Es war ein Krieg, in dem die russische Selbstwahrnehmung stark verletzt wurde, vor allem dadurch, dass feindliche Truppen in Moskau – damals zwar keine Hauptstadt, aber immer noch ein Symbol der Staatlichkeit – einmarschiert waren. In der Erinnerung wird dieser Krieg jedoch mit spektakulären Schlachten in Verbindung gebracht, in denen auf beiden Seiten zehntausende Soldaten fielen, wie bei der entscheidenden Schlacht bei Borodino, die doch nichts entschied. Die Gemälde und Gravuren mit dem in Brand gesetzten und nahezu vollständig abgebrannten Moskau – dem immer noch nicht restlich aufgeklärten und mythenumwobenen Höhepunkt des Krieges – stehen in der Erinnerung neben Bildern der erfrorenen, verhungerten und halbnackten Soldaten der Grande Armée, die Ende des Jahres aufhörte zu existieren. Scham und Stolz, beides begleitet die Erinnerung an den Krieg von 1812.
„Die Kinder des Jahres 1812“
Nicht weniger wichtig ist aber abseits der Frontlinien, Schlachten und Feldzüge das individuelle Erleben des Krieges von 1812, das dem Begriff des „Vaterlands“ (patria), um den schon das Denken der Gelehrten im 18. Jahrhundert kreiste, unbekannte Nuancen hinzufügte. Es formte eine romantische Persönlichkeit, der die Muster der eigenen Erziehung zu eng wurden. Tagebücher, Briefe und Erinnerungen geben Auskunft über diese säkulare Transformation des Fühlens und Denkens. Im Schrecken und im Freiheitsgefühl des Wunderjahres kulminierte eine neue emotionale Kultur, um deren Maßstäbe nun der kaiserliche Hof und die Salons des Adels mit Freimaurerlogen, Lesegesellschaften, außerkirchlichen Frömmigkeitskreisen und patriotischen Geheimzirkeln konkurrieren mussten. Wer etwas auf sich hielt, strebte dem Idealbild eines Europäers nach, wie es etwa aus Nikolaj Karamsins Briefen eines russischen Reisenden oder seiner Schrift Über das alte und das neue Russland herauszulesen war. Tugendnorm und schicklicher Ausdruck von Gefühl, Freundschaft und Leidenschaft unterlagen veränderten Codes, die weit ins 19. Jahrhundert ausstrahlten und teils noch in der Gegenwart modern erscheinen. In Fluss geratene religiöse und moralische Vorschriften und Tabus erlaubten es dem Individuum, Wissen und Selbstvergewisserung in neuen geselligen Formen zu suchen.
Armeedienst, Bildung und Politik
Die jungen adeligen Offiziere, die aus den „Ausländischen Zügen“ 1813 bis 1815 (Sechster Koalitionskrieg) siegreich heimgekehrt waren, teilten ein ganz anderes Europa-Erlebnis als ihre lesenden und reisenden Vorväter. Sie knüpften soziale Netzwerke und verschafften dem Freiheitsstreben dichte und verzweigte Strukturen und Resonanzräume, die traditionsbildend wirkten. Trotz sowjetischer denkmalgestützter Vereinnahmungsversuche, die aus den Dekabristen Vorläufer des Roten Oktober machen wollten, durchzieht ihr umfängliches und widersprüchliches Erbe die Epochen über alle Zäsuren hinweg, und sei es bloß als Gestus des Widerspruchs gegen die Zumutungen des „Staates“.
Jenseits solcher Zuschreibungen, die meist der Legendenbildung des 19. Jahrhunderts verhaftet sind, repräsentieren die Generation von 1812 und die Rebellen von 1825 ein vielschichtiges gesellschaftliches Umfeld, das zwar vom Adel dominiert war, aber die Folgen des „Volkskrieges“, der Partisanenverbände und des bäuerlichen Aufgebots mitbedachte. So beschleunigte und vertiefte der „Vaterländische Krieg“ eine intellektuelle Revolution, die der sozialen Frage nicht länger ausweichen wollte. Während Poeten wie Michail Lermontow vor allem den ewigen Helden besangen, schuf Lew Tolstoi mit dem Jahrhundertwerk Krieg und Frieden bewusst ein Gegenbild, in dem der Zar fehlbar, gleichsam ein sterblicher Gott war. So hatten es schon einzelne Dekabristen im Verhör zu Protokoll gegeben.
Anfänge des politischen Denkens
Wer in die Archive mit den Prozessakten und die privaten Nachlässe eintaucht, begibt sich auf eine aufregende Reise in die Anfänge des politischen Denkens in Russland. Die Übersetzungen politischer Texte des 18. Jahrhunderts aus dem Französischen fielen unter den wissbegierigen Offizieren auf fruchtbaren Boden. Begriffe aus europäischen Diskursen füllten sich mit russischen Inhalten, wurden zurücktransferiert, stießen einen transnationalen Gedankenaustausch an. Es ist wenig sinnvoll, in diesem frühen Ideen-Geflecht „Radikale“ von „Romantikern“, „Konservative“ von „Liberalen“, „Revolutionäre“ von „Reaktionären“, „Aufrührer“ von „Dichtern“ oder „Westler“ von „Slawophilen“ streng unterscheiden oder gar gegeneinander ausspielen zu wollen. Eher besteht die Kunst darin, zu verstehen, wie diese Gegensätze in ein und derselben Person koexistieren konnten. Auch in Verfassungsentwürfen wurden Elemente der „Diktatur“ mit Postulaten der „Demokratie“ und religiöse Toleranz mit dem Gebot einer Staatsreligion unbefangen zusammengedacht.
Russland als Ordnungsmacht
Alexander I. und sein Nachfolger Nikolaus I. ernteten die Früchte des Sieges über Napoleon. Nach dem prunkvollen Wiener Kongress beziehungsweise nach dem schockierenden Aufstand von 1825 wandten sich beide von sozialen Reformen ab. Dennoch veränderte sich Russland grundlegend. Es war nicht nur Großmacht geworden, die der Heiligen Allianz der drei Throne bei der politischen Neuordnung des Kontinents den Stempel aufdrückte, sondern öffnete sich gegenüber der europäischen Kultur, wie Europa sich nach Osten öffnete. Wenn fortan die Verhältnisse auf dem Kontinent stabilisiert oder verändert werden sollten, war das Zarenreich stets Zünglein an der Waage, gleichgültig, ob ihm die Rolle eines „Retters“, „Befreiers“ oder „Gendarmen“ Europas zufiel.
Daraus erwuchs mehr als ein außenpolitischer Einfluss, der bei Aufständen und Revolutionen wie 1830/31 in Frankreich und Polen oder 1848/49 im Deutschen Bund, in Preußen und dem Habsburgerreich auch militärisch zur Geltung gebracht werden konnte. Russland wollte sich zugleich als Hort der legitimen Monarchie zeigen und mit seiner „befriedeten“ Gesellschaft den „anarchischen“ republikanischen Staaten den Spiegel vorhalten. Indessen waren die Kategorien einer „gegenrevolutionären“ Sicherheitspolitik, die innere und auswärtige Belange miteinander verknüpfte und selbst das Privatleben als Feld argwöhnischer Beobachtung entdeckte, keineswegs spezifisch russisch. Überall in Europa und selbst in den transatlantischen Beziehungen wurde nach adäquaten Mitteln gesucht, die „revolutionäre Pest“, deren Ursprung in der Französischen Revolution gesehen wurde, einzudämmen oder ihr frühzeitig vorzubeugen. „Gendarmen“ flanierten offen durch den Alltag der Bürger und Untertanen, nach den Karlsbader Beschlüssen und im deutschen Vormärz eher inkognito.

Maler, Musiker, Dramaturgen wurden nicht müde, den Krieg stets aufs Neue nachzugestalten (Wassili Wereschtschagin, 1887-1895)
Symptomatisch für die Verschiebung der Machtverhältnisse war nicht zuletzt, dass den Regenten und ihren Kanzleien die Gestaltungshoheit über den wachsenden öffentlichen Raum zu entgleiten drohte. Journale, Zeitungen und Flugblätter unterlagen zwar der Zensur, lieferten aber dennoch wirkmächtiges Wissen und brisante Information. Seit der Jahrhundertwende neu gegründete Universitäten erweiterten die Bildungsgesellschaft in Russland und boten ein Forum für den transnationalen gelehrten Austausch.
Der Vaterländische Krieg ragt aus dem Zyklus monumentaler Geschichtsbetrachtung hervor. Er war präzedenzlos, auch wenn Zeitgenossen der napoleonischen Kriege die „Zeit der Wirren“ zu Beginn des 17. Jahrhunderts ins Gedächtnis riefen, als auswärtige Mächte die Vakanz auf dem russischen Thron zur Intervention nutzten. Im August 1914 war es anders. Nun sollte der heraufziehende Weltkrieg zum „Zweiten Vaterländischen Krieg“ erklärt werden. Doch bedrohte dieser Krieg die staatliche Ordnung und erschütterte die sozialen Strukturen in ganz anderer Weise als sein vermeintliches Vorbild.