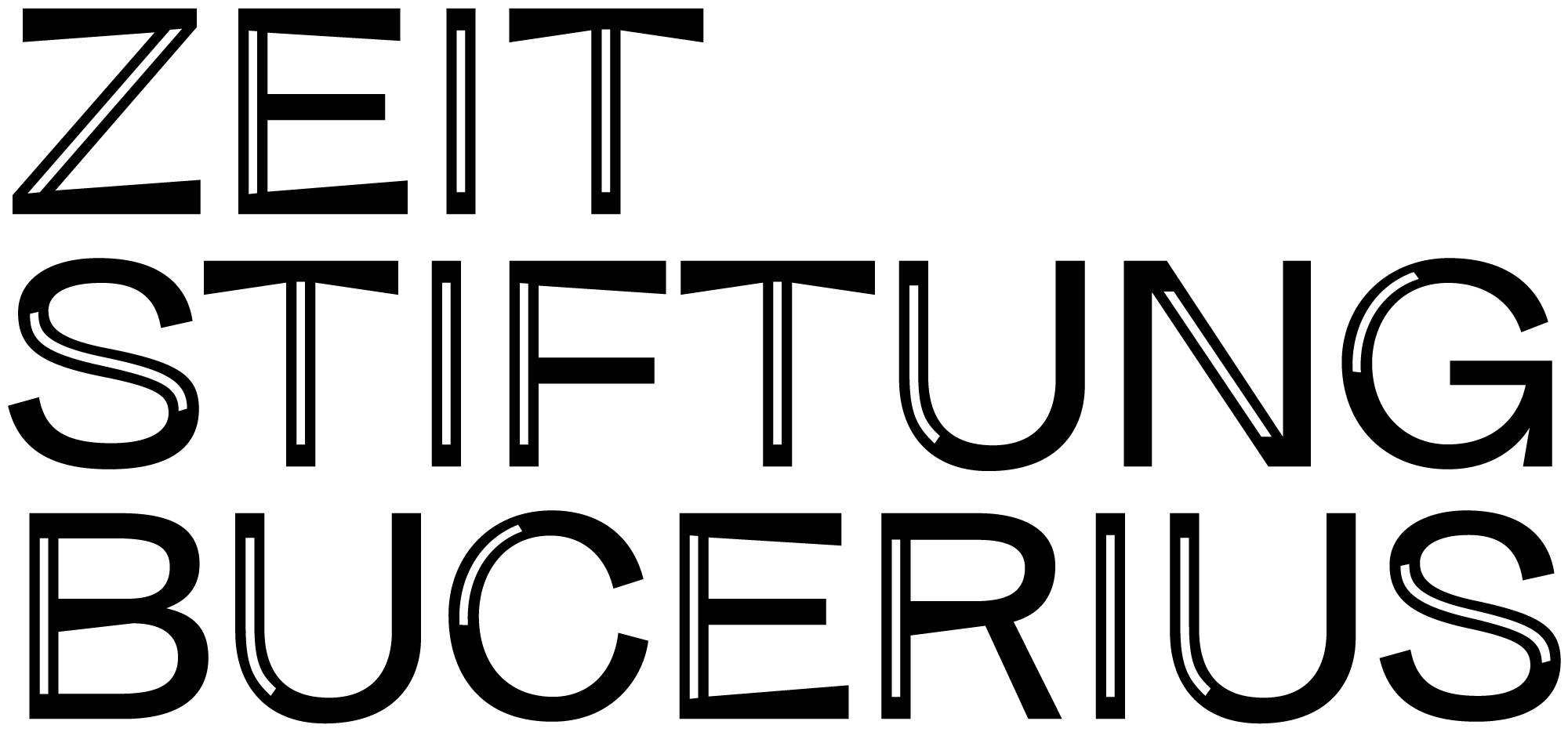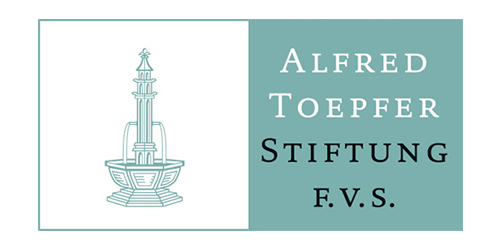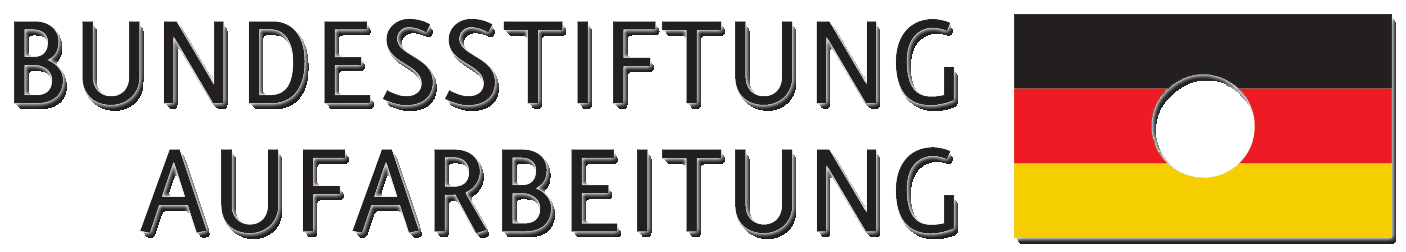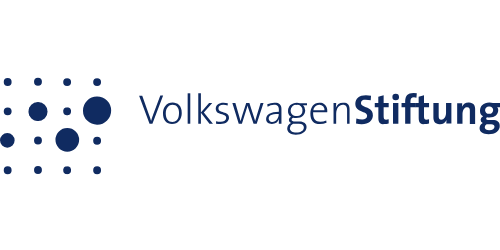Als Janka Bryl und seine Schriftstellerkollegen in den Nachkriegsjahren durch die verwüsteten und ausgebrannten Dörfer in Belarus reisen und Zeugnisse der Opfer des NS-Vernichtungsfeldzugs sammeln, ist ihnen nicht bewusst, dass sie den Grundstein eines neuen dokumentarisch-literarischen Schreibens legen werden. Alle drei Autoren, Bryl, Uladsimir Kalesnik und Ales Adamowitsch werden seither häufig in einem Atemzug genannt, denn nach ihren Recherchen von 1970 bis 1973 veröffentlichten sie gemeinsam das wegweisende Buch Feuerdörfer (belaruss. Ja s wohnennai wjoski).1
Mit den darin aufgeführten Protokollen der Überlebenden sollten sie viele spätere namhafte Autorinnen und Autoren prägen, darunter Swetlana Alexijewitsch, die sich dieser Schreibtradition verschrieb und der schließlich 2015 mit dem Literaturnobelpreis höchste internationale Anerkennung zuteil wurde.
Nach dem Überleben als junger Partisane wurde Janka Bryl im sowjetischen Belarus zum Romanautor, Interviewer, Dokumentarist und Schriftsteller und fand auch im unabhängigen Belarus nach dem Zerfall der Sowjetunion seine literarische Stimme. Was trieb ihn an? Was prägte sein Schaffen?

Gemeinsam haben sie an dem dokumentarischen Buch „Feuerdörfer“ gearbeitet: Janka Bryl (l.) und Ales Adamowitsch (r.) / Foto: Uladsimir Kalesnik, 1970–1973, © Privatarchiv Natalia Adamowitsch
Für einen allein wäre es sicher schwierig geworden, die vielen Besuche bei den Überlebenden in insgesamt 147 bereisten Dörfern zu bewältigen, geschweige denn all das Gesagte zu dokumentieren. So teilten sich Ales Adamowitsch, Uladsimir Kalesnik und Janka Bryl die Arbeit am Buch Feuerdörfer. Der Produktionsprozess umfasste verschiedene, aufeinanderfolgende Aufgaben: Recherche der insgesamt 300 Überlebenden, Reise in die Dörfer sowie die Interviews und das Notieren des Erzählten. Während der eine das Gespräch in die Hand nahm, schaltete der andere das Diktiergerät ein oder führte die Notizen, der dritte fotografierte. 1975 erschien das umfassende Werk und holte das Erinnern an die NS-Politik der „verbrannten Dörfer“ aus dem Privaten in eine bis dahin einzigartige literarisch-dokumentarische Form.2 „Feuerdörfer“ gilt seitdem als Grundstein für die belarusische Dokumentarliteratur der Nachkriegszeit und gibt sich in den Anfangspassagen explizit als dokumentarisch aus, als „eine dokumentarische Tragödie, eine Buch-Erinnerung, die lebendige Stimme von Menschen, die zusammen mit der Grube, zusammen mit ihrem Dorf verbrannt, getötet wurden und die – leben.“3
Neben dem dokumentarischen Interesse an den zerstörten Dörfern der Kriegszeit, beschäftigt sich Janka Bryl – der am 4. August 1917 in die Familie eines Eisenbahnarbeiters im ukrainischen Odesa geboren worden war – auch mit dem friedlichen Leben in belarusischen Dörfern in seinen zahlreichen Erzählungen und lyrischen Miniaturen. So beispielsweise auch im Sammelband Ein Kanten Brot4 (belarus. Akraec chleba, 1977) Ende der 1970er Jahre, in dem er 27 Erzählungen, Kurzgeschichten und sogenannte „lyrische Aufzeichnungen“ versammelte. Behandelt werden die Geräusche des Dorflebens und wie sie den Rhythmus des Alltags und der Arbeit bestimmen; der Erzähler stellt zudem lyrische Reflexionen zum Dichter Kusma Tschorny an; andere Kapitel handeln von der Einfachheit des Lebens auf dem Land und beschreiben typische Tätigkeiten: Mal wird ein Dach repariert, mal muss das Feld gemäht werden. Dabei hat die Erzählung mit dem Titel „Der Junge“ einen autobiographischen Bezug – ein Junge behauptet sich in Zeiten des Krieges mit tapferen Überlebenstechniken.
Kindheit zwischen altem und neuem Krieg
Tatsächlich war auch Janka Bryls Kindheit von Brüchen durchzogen: Nach seiner Geburt zog die Familie aus dem von Oktoberrevolution und Erstem Weltkrieg verwüsteten Odesa zurück in den Heimatort des Vaters, nach Sagorje bei Karelitschy im westlichen Belarus. Dort ging Bryl in eine polnische Schule, da dieses Gebiet – ebenso wie Teile der Ukraine – nach dem Frieden von Riga im Jahr 1921 zwischen Warschau und der späteren sowjetischen BSSR aufgeteilt worden war. So machte er früh Bekanntschaft mit polnischer, aber auch belarusischer Literatur. Später sollen auch russische Schriftsteller für ihn von Bedeutung werden.
Noch kurz bevor er 1939 nach dem Überfall des nationalsozialistischen Deutschlands auf Polen in die polnische Armee einberufen wird, war es ihm gelungen, erstmals einige seiner Gedichte zu veröffentlichen: 1938 in der belarusischen Zeitschrift Der Weg der Jugend (belarus. Schljach moladsi) in Vilnius. Doch als Angehöriger der belarusischen Minderheit in Polen muss er sich im Alter von 22 Jahren zunächst der Realität des Krieges stellen. Bereits nach drei Wochen geriet er in der Nähe von Gdynia in deutsche Gefangenschaft (Stationen: Stettin, Glashütten und Bayern). Dort musste er Zwangsarbeit verrichten, konnte jedoch beim zweiten Versuch fliehen und im Herbst 1941 in seine Heimat zurückkehren. Doch ließ ihm der Krieg keine Ruhe, so dass er sich im Frühling 1942 der Partisanenbrigade Schukow Baranowitsky anschloss. Für das antifaschistische Flugblatt Partisanenbajonett (Partysanskoe Shigala) und die Untergrundzeitschrift der KP Flagge der Freiheit (belarus. Szjah swabody) war er als Redakteur tätig, schrieb ab Oktober 1944 in Minsk auch selbst für die Zeitschriften Vozhyk, Moladost und Polymya. Von da an begann er zudem, zahlreiche Romane und Erzählbände zu veröffentlichen.

Im Gespräch mit Zeitzeugen: Ales Adamowitsch (l.) und Janka Bryl (r.) / Foto: Uladsmir Kalesnik, 1970-1973 © Privatarchiv Natalia Adamowitsch
Die belarusische Partisanenprosa
In der Nachkriegszeit begann Bryl, Erlebnisse und Beobachtungen aufzuschreiben, die er in den deutschen Lagern während seiner Gefangenschaft und Zwangsarbeit gemacht hatte, und sie in Form von fiktionalen Geschichten zu veröffentlichen. Für diese autobiographische, lyrische und philosophische Prosa erlangte er schnell Bekanntheit. Drei Erzählbände erschienen vor Stalins Tod, außerdem der bekannte Roman Der Tag bricht an in den Sümpfen (belarus. U Sabalozzi dneje), der Anfang der 1950er Jahre mit dem Stalinpreis ausgezeichnet wurde. Die folgenden Werke, meist Sammlungen von Kurzgeschichten und Romanen, handeln vom Dorfleben im westlichen Belarus in den Zwischenkriegsjahren und vom Widerstand gegen die deutschen Besatzer während des Zweiten Weltkriegs.
Mit dem Erscheinen von Vögel und Nester (belarus. Ptuschki i hnjosdy) im Jahr 1964 erfährt seine Literatur den Höhepunkt an Rezeption. Die Handlung des Romans spielt in zwei Zeitspannen, in den Jahren 1942 bis 1944 sowie 1962 bis 1964, und verflechtet epische, lyrische und auch volkstümliche Elemente und Themen. Bryl schreibt hier de facto aus seinem Gedächtnis, die Handlung war erneut autobiographisch motiviert: „Ich bin ein Schriftsteller von autobiographischer Art.“5 Im Mittelpunkt des Romans steht die Figur Ales Runjewitsch, der mit seinen Gefährten als Kriegsgefangene nach Deutschland verschleppt wird und die dort versuchen zu fliehen. Der Roman ist in drei miteinander verbundene, aber eigenständige Abschnitte gegliedert: Der erste Teil beschreibt Ales Runjewitschs Kindheit und Jugend in seiner Heimatregion Nawahrudak im westlichen Belarus, wo der Held des Romans – wie auch Bryl selbst – aufwuchs. Der zweite und umfangreichste Teil schildert die Zeit als Kriegsgefangener ab 1939, nach dem deutschen Überfall und der Teilung von Polen, Belarus, der Ukraine und der baltischen Länder im Zuge des Hitler-Stalin-Pakts. Im dritten Teil kämpft der Protagonist nach seiner Flucht nach Belarus unter dem Namen Jurka Bondar als Partisan. In seinem Versteck diktiert der Protagonist einer Schreibkraft seine Geschichte. Dadurch entsteht ein Roman im Roman und durch diese anspruchsvolle Komposition wird das Schreiben des Romans Ptuschki i hnjosdy (dt. Vögel und Nester) selbst imitiert. Die titelgebenden „Vögel und Nester“, die der Held in deutscher Gefangenschaft am Himmel beobachtet, avancieren zur Metapher für Flucht und Heimkehr.6 Bryl bezeichnete Tolstoi und dessen Realismus als Vorbild; in diesem Sinne steht dieser Held typenhaft für das belarusische Volk: Der Held verwirklicht sich, wie es im Klappentext zur DDR-Auflage heißt, auf „sein[em] Weg vom Tolstoianer zum sowjetischen Partisanen“.7
Wanderer zwischen den Kulturen
Nicht zuletzt hat sich die Verflechtung polnischer, ukrainischer, belarusischer und russischer Kultur in seinen literarischen Arbeiten niedergeschlagen, die typisch ist für Belarus als europäischem Verflechtungsraum. In Bryls Schaffen zeigt das zum Beispiel die Erzählung Zwei Stürme (belarus. Dva shtormy) von 1994 sehr exemplarisch, die einerseits eine deutliche Referenz auf Michail Lermontows Ein Held unserer Zeit als sowjetisch-russischem Klassiker aufweist – und andererseits wie selbstverständlich polnische Dialekte einfließen lässt: „Als wir nach einer Vielzahl an gefährlichem Hin- und Herschaukeln ans, von Büschen überwucherte Ufer geschmissen wurden, haben wir dort – das betone ich genauso – ehrliche Schnapsbrenner erschreckt. In Einsamkeit bei schlechtem Wetter, bedeutet: in der Notwendigkeit von Sicherheit, haben sie – während sie auf einem örtlichen Dialekt sprachen – auf polnische Manier ihren ‚Kschakuuku‘8 gebrannt – in den ‚Kschakas‘, in den Büschen.9“ Auch seine Bekannt- und Freundschaften zeugen von seiner multikulturellen Prägung. So verband ihn beispielsweise eine tiefe Freundschaft mit dem tschechischen Literaturwissenschaftler, Übersetzer und Professor an der Karls-Universität in Prag Václav Židlický10, der sich intensiv der Geschichte der belarusischen und ukrainischen Literatur widmete und enge kulturelle Verbindungen mit belarusischen Schriftstellern pflegte (er hatte unter anderem Ales Adamowitsch und Wassil Bykau ins Tschechische übersetzt). Eine freundschaftliche Verbindung pflegte Bryl ebenso zum polnischen Literaturkritiker und Historiker Adam Maldzis, der sich für die kulturelle Verständigung zwischen Belarus und Polen einsetzte. Bryls gelebter Multilingualismus war auch entscheidend für seine Übersetzertätigkeit: Nicht zuletzt ist er für seine Übersetzungen von Tolstoi, Tschechow und Gorki ins Belarusische bekannt geworden. Auch aus dem Ukrainischen übersetzte er, darunter Oleksandr Dowschenko, Ostap Vischnja, ebenso aus dem Polnischen, darunter Eliza Orzeszkowa, Tadeusz Różewicz, Bolesław Prus und Jarosław Iwaszkiewicz.
Leise Kritik an Stalin, „Brief der 28“ und politische Vereinnahmung
Während der Sowjetzeit ist Bryl zweimal gewählter Abgeordneter des Obersten Rates der BSSR (1963–1967, 1980–1985). 1981 wird er zum „Volksschriftsteller“ ernannt. Obwohl er überdies zahlreiche sowjetische Literaturpreise erhielt und staatliche Posten im offiziellen literarischen Leben bekleidete, etwa als Sekretär des Belarusischen Schriftstellerverbandes (1966–71), ließ er in seinem Werk durchaus kritische Töne anklingen. „Vögel und Nester“ lässt sich auch kritisch in Bezug auf Stalins großen Terror lesen: Bryl verarbeitete in diesem Roman sowohl die Unterdrückung der ethnischen Belarusen durch Polen als auch derjenigen Belarusen, die aus Überzeugung in die sowjetische BSSR übersiedelten, teilweise verhaftet und ins Gulag verbannt wurden. In Bryls Roman wird Belarus als ein von Polen und Russland umkämpftes Land in den Zwischenkriegsjahren dargestellt, womit er an die tatsächliche Zerrissenheit der Regionen anknüpfte, in denen er selbst groß geworden war.
Wegen der literarischen Verarbeitung dieses polnisch-belarusischen ‚Grenzlebens‘ wurde er von der sowjetischen Geschichtsschreibung, so etwa in einer sowjetisch-belarusischen Biographie über ihn aus dem Jahr 1961, schließlich vereinnahmt und zum Kritiker eines angeblich faschistischen Polens stilisiert.
1986 gehört er neben seinen Schriftstellerkollegen Wassil Bykau, Ales Rasanau, Ryhor Baradulin und anderen prominenten Stimmen der belarusischen Literaturszene zu den Unterzeichnern des sogenannten „Brief der 28“ an den damaligen Generalsekretär der KPdSU Michail Gorbatschow. Darin beklagten sie das Schwinden der belarusischen Sprache, abzulesen unter anderem daran, dass um die 90 Prozent der in der Sowjetunion gedruckten Werke auf Russisch erschienen: „Es gibt praktisch auch keine Filme in belarusischer Sprache.“ Man müsse, hieß es, „das belarusische Volk vor dem geistigen Niedergang retten.“11 Damit ebneten sie den Weg dafür, dass Belarusisch im Zuge der Perestroika Anfang 1990 der Status einer Amtssprache in Belarus zuerkannt wurde.
Im heutigen Belarus wird Bryls literarische Autorität – wie die seiner Kollegen – unter den Vorzeichen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine instrumentalisiert: In einem heute von Geschichtsrevisionisums und Propaganda geprägten Umfeld werden beispielsweise in der Gedenkstätte12 von Chatyn die Manuskripte, Bücher und Schreibmaschinen von Adamowitsch, Bryl und Kalesnik präsentiert und lassen sie als Kanon der Rechtfertigung erscheinen.

Janka Bryl kurz vor seinem 70. Geburtstag © gemeinfrei
„Es lebe Belarus“
Seit 1989 war Bryl Mitglied des belarusischen PEN-Zentrums, seit 1994 Ehrenmitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften von Belarus. Obgleich er sich nicht dezidiert als Oppositioneller hervorgetan hat, lassen seine Essays aus den 1990er Jahren seine Fürsprache für die Unabhängigkeit von Belarus allgemein und der belarusischen Sprache insbesondere erkennen. Beispielsweise beschreibt er im Band Mit Menschen und allein (belarus. S ljudsmi i sam-nasam) einen sonnigen, warmen Tag zu Beginn der 1990er Jahre, an dem er einen Protestmarsch mitlief und alle gemeinsam „Es lebe Belarus“ riefen – und weiter: „Es tat auch gut, sich bei den Versammlungen auf dem weiträumigen Aufgang des Sportpalastes neben einen unbekannten Mann hinzusetzen, in dessen Hand unsere Weiß-Rot-Weiße Flagge hoch und strahlend stand. Aus dem Gespräch ging zufällig hervor, dass er ein Arbeiter ist, bereits im Ruhestand und dass seine Füße schmerzen, obwohl er ganze siebzehn Jahre jünger ist als ich.“13
Auch die Erzählung Zwei Stürme (belarus. Dwa schtormy) von 1994 lassen seine Sympathie für den Weg der Unabhängigkeit klar erkennen. Darin verwebt er literarische Sturmmotive mit zwei eigenen autobiographischen Sturmereignissen (titelgebend für die Erzählung), die sich physisch und metaphorisch in den Jahren 1956 und 1957 zugetragen haben, über die er – wie er in der Erzählung offenlegt – nun nach über 32 Jahren reflektiert und schreibt. Während bei dem ersten Ereignis beinahe seine Tochter von Wellen weggerissen worden wäre (eine befreundete Schriftstellerin konnte sie retten), steht bei dem zweiten Sturm eine Bootsfahrt mit zwei Freunden im Zentrum, die beinah tödlich ausgegangen wäre. Bezieht man den aktuellen politischen Kontext des Erscheinens ein, so kann der Sturm als Metapher für die Zeit seit der Unabhängigkeit von Belarus im Jahr 1991 verstanden werden – als die lang ersehnte Chance, als Ungewissheit und Herausforderung auf dem Weg zur Eigenständigkeit.
Janka Bryl starb am 25. Juli 2006 im Alter von 90 Jahren in Minsk.
Anmerkung der Redaktion
Weißrussland oder Belarus? Belarussisch oder belarusisch? Die Belarus oder das Belarus? Nicht ganz leicht zu beantworten. Da es im Deutschen keine einheitlich kodifizierten Schreibweisen für diese Bezeichnungen und deren Adjektive gibt, überlassen wir es den Autorinnen und Autoren der Gnosen, welche Schreibweise sie verwenden. Die Schreibweise in redaktionellen Inhalten (wie Titel und Erklärtexte) wird von der dekoder-Redaktion verantwortet.
Literatur in Auswahl