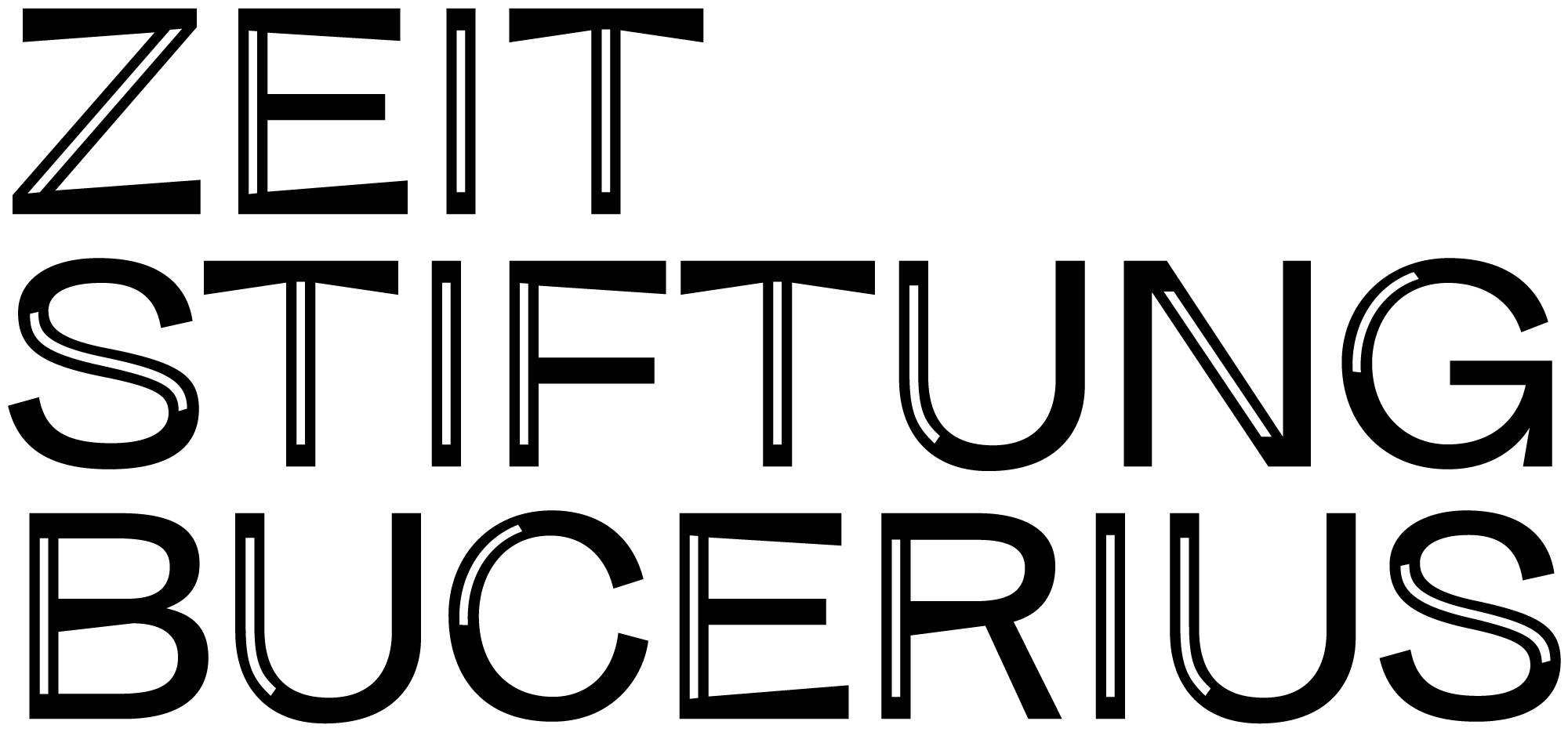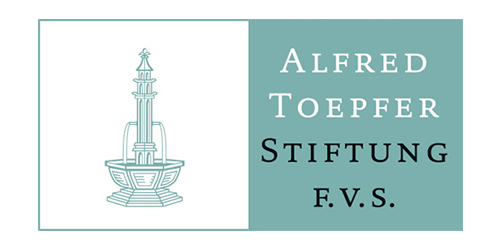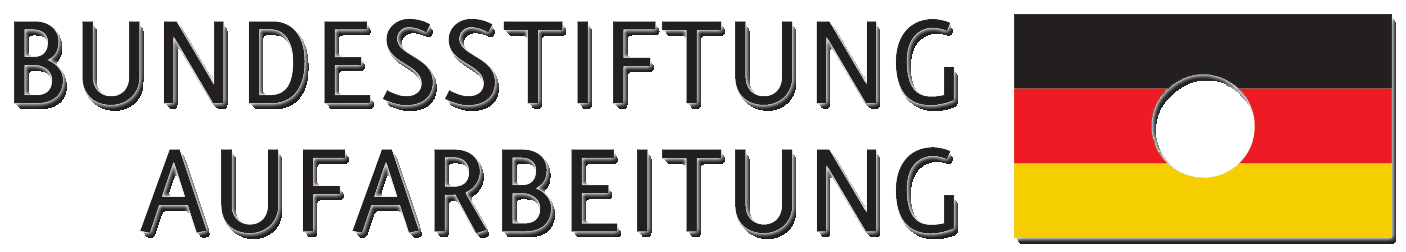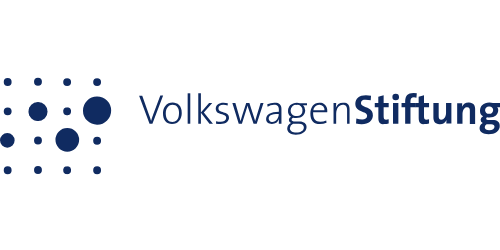Seit bald zehn Jahren, spätestens seit 2016, ist „häusliche Gewalt“ Dauerthema in russischen Medien. Damals zeichnete sich eine Entkriminalisierung von Gewalt im familiären Kontext ab, die 2017 Realität wurde. Menschenrechtsorganisationen und Fraueninitiativen weisen seit Jahren auf den fehlenden Opferschutz hin. Häusliche Gewalt ist ein weit verbreitetes Problem in Russland und wird dennoch weithin als Normalität akzeptiert. „Bjot - snatschit ljubit“ (dt: „Er schlägt, also liebt er“) ist ein althergebrachter, weit verbreiteter Spruch. Allein in den Jahren 2021-2022 sind in Russland fast 1000 Frauen von ihren Partnern oder nahen Verwandten getötet worden. Das ist mehr als ein Femizid pro Tag – und dabei noch eine Rechnung ohne Dunkelziffer.
Mit der Rückkehr kriegstraumatisierter russischer Soldaten aus den Kämpfen gegen die Ukraine in ihre Familien hat sich die Situation weiter verschärft, zumal bereits wegen häuslicher Gewalt verurteilte Straftäter unter ihnen sind. Überraschend scheint nun die Regierung selbst das Thema angehen zu wollen: Im Juni 2024 haben gleich zwei Parteien Gesetzesentwürfe vorgelegt, die das Problem der häuslichen Gewalt lösen wollen. Im Dezember kam noch ein Gesetzesvorschlag1 hinzu, der Geldstrafen für das Rechtfertigen häuslicher Gewalt vorschlägt. Entschieden und verabschiedet ist indes nichts davon.
In ihrer Gnose wirft die Theologin und Russland-Expertin Regina Elsner einen Blick in die Entwicklung häuslicher Gewalt und die gesellschaftlichen Debatten darum im Russland der vergangenen zehn Jahre.

Moskau im Februar 2017: „Er schlägt, also sitzt er ein“ - Protest gegen häusliche Gewalt und einen Gesetzentwurf, der die möglichen Strafen dafür abschwächen sollte. Foto © Sergei Fadeichev/TASS
Internationale Übereinkommen wie die Istanbul-Konvention definieren häusliche Gewalt als „alle Handlungen körperlicher, sexueller, psychischer oder wirtschaftlicher Gewalt, die innerhalb der Familie oder des Haushalts oder zwischen früheren oder derzeitigen Eheleuten oder Partnerinnen beziehungsweise Partnern vorkommen“. Die überwältigende Mehrheit der Opfer von häuslicher Gewalt weltweit sind Frauen. Russland hat neben Aserbaidschan als einziges Land des Europarates die Istanbul-Konvention nicht unterzeichnet und verfügt nach wie vor über kein Gesetz und keine juristische Definition von häuslicher Gewalt. Zudem ist es 2022 aus der Europäischen Menschenrechtskonvention ausgestiegen.
Viele Beobachter sehen Anzeichen dafür, dass Russlands Krieg gegen die Ukraine die häusliche Gewalt bzw. Gewalt konkret gegen Frauen innerhalb der russländischen Gesellschaft weiter normalisiert. Traurige Berühmtheit erlangte etwa der Fall Wladislaw Kanjus: Dieser hatte 2020 seine Freundin Vera Pechtelowa erschlagen und wurde dafür zu 17 Jahren Straflager verurteilt. Nach einem halben Jahr wechselte er in den Kriegsdienst. Dank seiner Begnadigung muss er nicht einmal mehr das Schmerzensgeld von vier Millionen Rubel an die Familie zahlen.2 Seit 2023 ist er frei.
Eine ähnliche Geschichte ereignete sich mit dem ehemaligen Polizisten Wadim Techow3: Er tötete seine Frau, wurde verurteilt, zog in den Krieg und kehrte zurück in deren Heimatstadt – in der nach wie vor die Schwester der Verstorbenen wohnte. Einheitliche Strategien – wie etwa obligatorische psychologische Betreuung – mit dem Umgang traumatisierter Kriegsheimkehrer gibt es in Russland keine. Ebenso fehlt es an Programmen zur Gewalt-Vorbeugung.
Statistiken und ihre Dunkelziffern
Bis 2016 wurden in Russland Übergriffe in Familien nach dem allgemeinen Strafrecht behandelt. Der Versuch, für häusliche Gewalttaten einen eigenen Strafbestand zu schaffen, scheiterte. Im Gegenteil: Seit 2017 werden erste und einmalige Übergriffe in Familien nur als Ordnungswidrigkeiten eingestuft und demnach mit kleineren Geldstrafen oder gemeinnütziger Arbeit bestraft.
Die Daten offizieller Umfragen bis 2017 zeigten bereits einen Anstieg von strafrechtlich verfolgten Gewalttaten auf 64.421 Fälle im Jahr 2016, davon 92 Prozent gegen Frauen. Aufgrund der Entkriminalisierung Anfang 2017 ging die Zahl in dem Jahr auf 34.007 zurück, für 2018 wurden 21.390 Fälle gemeldet. Eine Studie unabhängiger Medien von 2019 ergab, dass sich fast 80 Prozent der wegen Mordes verurteilten Frauen in Russland gegen Gewalt von Familienangehörigen gewehrt hatten. Da sie oft der körperlichen Stärke des Mannes ausgeliefert sind, greifen sie zur Abwehr zu Messern, was ihnen später als Überschreitung der Notwehr angelastet wird.
Für die Jahre 2021 und 2022 berichtet4 das russische Onlinemedium Verstka mit Verweis auf Daten des russischen Innenministeriums, dass 2021 448 Frauen durch ihre Partner oder nahe Verwandte getötet wurden, im Jahr 2022 – 447. Nach Polizeiangaben für den Zeitraum 2021 bis Juni 2023 waren 74 Prozent der Betroffenen häuslicher und familiärer Straftaten Frauen. Die Täter waren in 80 Prozent der Fälle Männer.
Da der russische Staat sich weigert, häusliche Gewalt als eigenständiges Problem (unter allen anderen Gewaltverbrechen) zu betrachten, werden keine Daten zur Zahl der Opfer veröffentlicht. Ein Zusammenschluss mehrerer Frauenrechts-Organisationen hat daher alle Gerichtsurteile zur Tötung von Frauen zwischen 2011 und 2019 systematisch ausgewertet. Über den Zeitraum von neun Jahren zählten sie 18.547 Verfahren. In zwei von drei Fällen waren die Frauen Opfer häuslicher Gewalt. In 53 Prozent der Fälle war der Partner der Täter. Nimmt man den Durchschnitt dieses Zeitraums, kommt man zu dem Ergebnis, dass in Russland jedes Jahr mehr als 1300 Frauen von ihren Partnern oder Familienangehörigen getötet werden. Ins Verhältnis zur Bevölkerungszahl gesetzt, ist die Gefahr, vom eigenen Partner umgebracht zu werden, in Russland damit sechsmal so hoch wie in Deutschland (im Schnitt etwa 130 Opfer im Jahr).
Statistisch ist die Situation kaum einzuholen, die Dunkelziffer dürfte um ein Vielfaches höher sein. Die Mehrzahl gewaltsamer Übergriffe im familiären Kontext wird nicht gemeldet, zahlreiche Anzeigen werden kurze Zeit später von den Opfern wieder zurückgezogen. Die Gründe dafür sind vielfältig: ein geringes Vertrauen in die Polizei; die weit verbreitete Vorstellung, dass physische Gewalt zur Normalität gehöre; ein fehlendes Bewusstsein von persönlichen Grenzen und der Unzulässigkeit, diese auch psychisch zu übertreten; sowie schließlich der fehlende Schutz vor dem Täter nach einer möglichen Anzeige. Die Beweislast liegt beim Opfer, eventuelle Geldstrafen oder der Lohnausfall fallen auf das Familienbudget zurück und setzten die Opfer zusätzlich unter Druck.
Oft nimmt die Polizei Anzeigen auch nur entgegen, wenn schwere Verletzungen oder Lebensgefahr vorliegen, viele Opfer häuslicher Gewalt haben vor einer Eskalation mehrfach erfolglos Hilfe gesucht.
Diese Umstände sind in Russland vor allem durch den Fall der drei Schwestern Chatschaturjan im Jahr 2018 bekannt geworden. Diese hatten ihren Vater getötet, nachdem dieser sie mehrere Jahre lang psychisch und körperlich misshandelt sowie sexuell missbraucht hatte. Nachbarn, Verwandte, Pädagogen und Polizei waren jahrelang informiert, handelten jedoch nicht. Nach der Tat wurden die Schwestern zunächst ohne Rücksicht auf die Umstände wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt, erst der massive Protest der Bevölkerung und das Eingreifen des Oberstaatsanwalts führten zu einer Herabstufung auf Notwehr.
Dieser Fall sowie weitere erfolgreiche Klagen von Opfern vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte haben schließlich zur Ausarbeitung eines neuen Gesetzes zur Prävention von häuslicher Gewalt geführt, dessen Entwurf im November 2019 veröffentlicht wurde und zu breiten Diskussionen führte. Es trat jedoch nie in Kraft.
Im April 2024 flammte die Debatte wieder auf, als im Nachbarland Kasachstan der ehemalige Wirtschaftsminister seine Frau ermordete und zu 24 Jahren Haft verurteilt wurde. Der zentralasiatische Staat verschärfte daraufhin seine Gesetzgebung. In Moskau kommentierte die Duma-Abgeordnete Nina Ostanina – die sich in ihrem Amt um Familien, Frauen und Kinder kümmern soll –, die im russischen Strafgesetzbuch festgelegten Gesetze seien ausreichend, um Frauen zu schützen.5 Überhaupt würde die Mehrheit der Frauen eine weitere strafrechtliche Regulierung häuslicher Gewalt ablehnen. Stattdessen solle man sich eher darum kümmern, die Kinder richtig zu erziehen – dann würde auch kein Missbrauch entstehen, ist Ostanina überzeugt.
Im Juni 2024 wiederum legten die Parteien LDPR und Nowyje Ljudi Gesetzentwürfe vor, die häusliche Gewalt eindämmen und speziell auch Männer schützen sollten. Nun unterstützte auch Ostanina die Initiative.6 Die Menschenrechtsbeauftragte Tatjana Moskalkowa rief zudem auf, überall im Land staatliche Krisenzentren einzurichten.
„Traditionelle Familienwerte“
Die Gesetzentwürfe gegen häusliche Gewalt werden sowohl von Menschenrechts- und Frauenorganisationen als auch von Vertretern der sogenannten „traditionellen Werte“ kritisiert. Organisationen, die sich seit vielen Jahren für einen effektiven Schutz vor häuslicher Gewalt einsetzen, sehen in den Vorlagen eine Farce. Die Entwürfe klammerten teils physische Gewalt aus (da diese bereits im Strafrecht verhandelt sei), beziehen sich nur auf verheiratete Personen und Paare mit Kindern, zielten in erster Linie auf einvernehmliche Einigung und damit den Erhalt der betroffenen Familie. Damit würde den Opfern erneut ein wirkungsvoller Schutz vorenthalten.
Ausgenommen seien damit kinderlose Frauen, die in nicht registrierten Beziehungen leben, und auch geschiedene Frauen, die vom ehemaligen Partner angegriffen werden. Gänzlich außerhalb der Diskussion bleibe außerdem die katastrophale Situation von Frauen im Nordkaukasus7 und damit die Frage nach der Durchsetzung von russischer Gesetzgebung insgesamt.
Das Ziel einer Versöhnung und der Bewahrung der Familie kommt allerdings jenen konservativen Kräften entgegen, die in jeglichen Gesetzen gegen häusliche Gewalt eine feindliche Attacke gegen das Institut der Familie an sich fürchten. Dazu gehören vor allem Patriarch Kirill (Gundjajew), orthodoxe Gruppierungen und offizielle kirchliche Strukturen wie die Patriarchale Kommission für Familie, Mutterschaft und Kindheit, die bis 2020 unter der Leitung des erzkonservativen Priesters Dmitri Smirnow stand, sowie das Allrussische Volkskonzil oder der Orthodoxe Frauenbund bis hin zu dem orthodoxen Oligarchen Konstantin Malofejew und seinem Medienimperium Tsargrad.
In deren Argumentation gefährde jedes Eingreifen in den „heiligen Raum der Familie“ die Stärkung der russischen Demografie und damit das Bestehen des russischen Volkes. Unter dem Vorwand der Menschenrechte würden radikale feministische Ideologien die staatliche Familienpolitik unterwandern, deren Ziel die Stärkung eines positiven Familienbildes sein müsse. Gesetze gegen häusliche Gewalt würden jedoch den gegenteiligen Eindruck vermitteln, Familien und Männer seien per se nur eine Gefahr für Frauen und Kinder. Leichte körperliche Züchtigung und die Unterordnung der Kinder unter die Eltern gehört in ihrer Vorstellung zum traditionellen Familienkonzept.
Dahinter verbirgt sich auch die Überzeugung, dass individuelle Menschenrechte, hier der Schutz von Frauen oder Kindern, nie über die Rechte der Gemeinschaft gestellt werden dürfen. Dieser Grundsatz wurde 2008 in einem Grundlagenpapier8 der Russischen Orthodoxen Kirche zu den Menschenrechten formuliert und dominiert seitdem den orthodoxen Umgang mit Menschenrechtsthemen. Durch die Priorität von patriarchaler Familie, Kirche und Staatsgewalt in der kirchlichen Argumentation bleibt ihre grundsätzliche Haltung gegen „tatsächlich stattfindende Gewalt“ unglaubwürdig.
„Ausländische Propaganda“
Kirchliche und staatliche Gegner der rechtlichen Maßnahmen zur Prävention und Verfolgung häuslicher Gewalt arbeiten vor allem auch mit dem Vorwurf, ausländische Akteure und Ideologien würden damit gegen russische Traditionen vorgehen. Es sei der „kollektive Westen“9, der von außen versuchen würde, Russland „zweifelhafte“ Normen aufzuzwingen. Damit stigmatisieren sie vor allem die Arbeit der nichtstaatlichen Organisationen, die sich für den rechtlichen Schutz, Notunterkünfte und psychologische Beratung für die Opfer häuslicher Gewalt einsetzen.
Neben bekannten NGOs wie den Zentren ANNA und Sestry und der Anwaltsvereinigung Prawowaja Iniziatiwa zählen dazu auch einige kirchliche Einrichtungen. Ohne einen grundlegenden gesetzlichen Schutz können diese Zentren jedoch nur punktuell unterstützen, sie stehen immer in der Kritik, gegen die „russische Tradition“ zu arbeiten. Viele von ihnen sind inzwischen außerdem zu „ausländischen Agenten“ erklärt worden, da sie häufig durch ausländische Spenden finanziert wurden.
Die bisherige Nicht-Umsetzung der Gesetzvorschläge von 2019 und 2024 bedeutet, dass russische Frauen in naher Zukunft keinen rechtlichen Schutz vor häuslicher Gewalt erwarten können. Da Russland kein Rechtssaat ist, stellt sich aber auch die Frage, inwieweit ein solches Gesetz überhaupt wirksam wäre. So oder so – die Opfer häuslicher Gewalt in Russland werden zahlreich und weiterhin schutzlos bleiben.